Meine Kindheit war scheisse. Jetzt habe ich selber ein Kind…
Wie wirkt sich die eigene Kindheit aufs Elternsein aus? Kann man alte Muster durchbrechen?

Wie wirkt sich die eigene Kindheit aufs Elternsein aus? Das beschäftigt viele – auch unsere anonyme Schreiberin. Sie nimmt uns mit in ihre Gegenwart und Vergangenheit.
Ich sitze mit meiner Tochter auf einer Bank. Die Sonne am blauen Himmel strahlt so fest, wie sie das im Januar halt tun kann. Ich geniesse die Aussicht auf Hügel, Wiesen und unseren Wohnort. Die Kleine beobachtet die Strasse mit den vorbeifahrenden Autos.
Ein simpler Alltagsmoment, der mein Herz voll und den Kopf leer macht. Ich spüre, wie sehr ich gerade hier bin, in diesem Moment. Wie fest ich bei mir sein kann und trotzdem verbunden bin mit dem kleinen Wesen an meiner Seite.
Ich bin in diesem Augenblick dankbar für den Weg, den ich gehen durfte. Und dankbar dafür, dass nicht alles perfekt sein muss, dass ich straucheln darf, verzweifeln und trauern. Dass ich fühlen darf, was ich gerade fühle.
***
Nie vergesse ich diesen Moment. Es gab viele solcher Momente. Aber dieser ist mir ganz besonders geblieben. Ich bin etwa 11 Jahre alt und liege unter meinem Bett. Weine wie nie zuvor. Heisse Tränen laufen über meine Wangen.
Meine Mutter hat mich zuvor minutenlang beschimpft und beschämt. Bei Weitem nicht zum ersten Mal. Wahrscheinlich ist gerade wieder ein Teil meines Herzens gestorben. Ich spüre meinen Körper nicht mehr, ich kann bloss weinen. Und nur noch eines denken: Ich habe es nicht verdient zu leben.
Es poltert auf der Treppe. Sie kommt. Hilfe!
Ich bin noch immer unfähig, mich von der Stelle zu bewegen. Und weiss gleichzeitig, dass ich es damit noch schlimmer mache. Sie reisst die Tür auf, kommt wutentbrannt in mein Zimmer und drischt weiter mit Worten auf mich ein.
Ich weiss nicht mehr, warum sie so wütend war. Mama ist oft wütend. Wegen allem und jedem. Schuld sind wir Kinder, unser Vater, ihre Freunde, «das Dorf», der Hund… Irgendwer. Nur nie Mama.
Sie baut sich im Türrahmen nochmal auf und ich meine, mich an einen kurzen Moment der Unsicherheit in ihrer Mimik zu erinnern. Sie kommt zu sich. Und sagt mir, dass ich jetzt aufhören kann zu heulen. Ich sei einfach selber schuld. Sie müsse so zu mir sein. Weil ich halt immer «so» sei.
Ich schlucke den Hass, die Wut, die Trauer und Verzweiflung hinunter und setze mich auf. Meine Glieder sind schwer. Ich will sterben, denke ich.
***
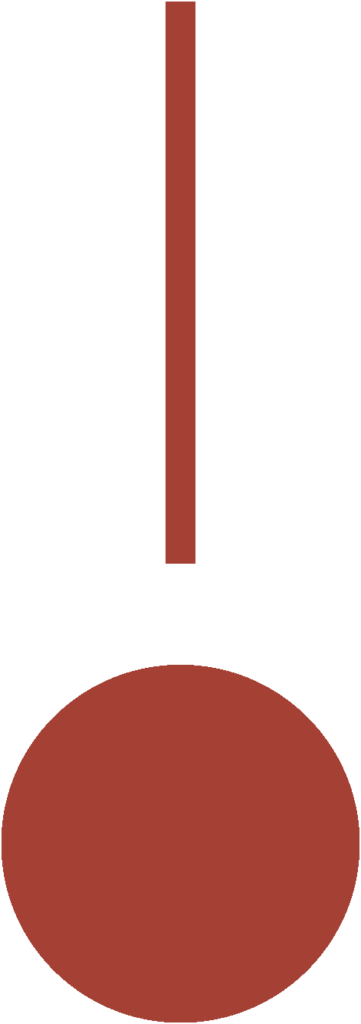
Wir werden diesen Beitrag noch aufbretzeln für unsere neue Webseite. Drum sieht momentan nicht alles rund aus. Aber mal ehrlich: gut genug. Danke für deine Geduld!
Meine Tochter weint. Sie kann wie so häufig schlecht einschlafen. Ich halte sie in meinen Armen und sage Dinge wie «Es ist ok», «Ja gell, es ist schwierig» oder «Erzähl mir, was dich traurig macht» und «D Mama isch da».
Mittlerweile kann ich in diesen Momenten meistens soweit bei mir bleiben, dass ich für sie da sein kann, ohne mich in ihrer Verzweiflung zu verlieren.

Ich weiss, dass sie sich so ausdrückt und Spannung abbaut. Und ich spüre auch, wann der Zeitpunkt da ist, meinen Mann um Hilfe zu bitten. Wann ich mal eine Nacht in einem anderen Zimmer schlafen oder einfach nur ein paar Stunden alleine raus muss.
Ich glaube, dass dies Grenzen sind, die viele Mütter und Väter kennen. Ich bin aber auch überzeugt, dass das Elternsein mit einem so schlechten Vorbild, einem grossen Defizit an elterlicher Nestwärme und mangelhaften Regulationsmechanismen, erschwert sein kann.
So viel geben zu wollen, diese schier unendliche Liebe zu spüren, obwohl ich selber über Jahre sehr wenig bekommen habe – das ist die grösste Challenge meines Lebens. Denn es lebt in mir immer noch das schwer traumatisierte Geschöpf von damals, das nie in den Arm genommen wurde. Dessen Emotionen negiert, kleingeredet und ignoriert wurden. Es sagt manchmal ganz leise: «Hey, und ich?»
Ohne die Hilfe meiner Therapeutin, die Unterstützung meines Mannes, die offenen Ohren und Herzen meiner Freund:innen würde ich mich wohl irgendwann im Wirrwarr verlieren, wahrscheinlich unter der Last, es «besser» machen zu wollen als meine Eltern, zerbrechen.
Es ist wichtig für mich, dass ich nicht perfekt sein muss. Und dass gut gut genug ist. Auch mal müde zu sein und meine Grenzen zu setzen, ist dafür unbedingt nötig, fällt mir jedoch schwer.
Denn seit der Geburt meiner Tochter werde ich merklich schneller getriggert und befinde mich in solchen Momenten sofort wieder unter diesem Bett, in dem furchtbaren und dreckigen Haus und habe nur eines im Kopf: Ich gehöre nicht auf diese Welt. Niemand hat darum gebeten, dass ich hier bin.
Das passiert insbesondere dann, wenn ich mich allein, überfordert, unverstanden und unwichtig fühle. Und gerade Letzteres sind wir doch als Eltern alle plötzlich irgendwie. Unwichtiger als zuvor. Wir stellen die Bedürfnisse der kleinen Geschöpfe über die eigenen.
In den ersten Monaten nach der Geburt wurde ich oft hin- und her geschleudert auf der Gefühlsachterbahn. Einerseits wollte ich sehr fest für meine Tochter da sein, sie meine Liebe spüren lassen. Andererseits kam etwas in mir nicht klar damit, dass ich erstmal die Kontrolle über alles, was mich ausmachte, verloren hatte. Konflikte mit meinem Mann darüber, wer jetzt was macht und was das Beste für unser Kind ist, verschärften die Situation zusätzlich. Vom Schlafmangel und dem ständigen Alleinsein mit dem Kind ganz zu schweigen.
Für meinen Mann war das auch eine sehr schwere Zeit, die Spuren hinterliess. Er hatte Angst um mich und unsere Tochter und musste trotzdem im Alltag funktionieren. Heute noch ist er davon erschöpft und hat Mühe damit, die Angst loszulassen und meiner Stabilität zu vertrauen.
***
Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ich schloss meine schulische Ausbildung mit Bravour ab, war stets hochperfektionistisch. Rückschläge und Fehler oder schon nur mal nicht top zu sein, konnte ich schlecht aushalten. Ich war immer eher angepasst, mir war es unheimlich wichtig, zu gefallen. Und ich erachtete es bis ins Erwachsenenalter als zentral, dass es allen rund um mich herum gut geht.
Heute weiss ich: Nicht etwa aus purer Nächstenliebe, sondern vor allem, weil ich Unstimmigkeiten und Unzufriedenheit meiner Umgebung direkt auf mich projiziert habe. Wenn es jemandem nicht gut ging, hatte das direkt mit mir zu tun. So hatte ich es von klein auf gelernt. Ich fühlte mich ständig schuldig, verletzt und allein.
Meine Mutter war cholerisch, jähzornig und verbal grob gewalttätig. Schuld daran wie oben beschrieben: Alle. Als Kind glaubt man das. Man ist den Eltern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Man liebt sie bedingungslos. Sie stehen auf einem unumstösslichen Sockel. Logisch, denn Kinder sind auf ihre Eltern angewiesen.
Reiner Selbstschutz also, dass ich die Wut, die eigentlich meinen Eltern galt, gegen mich selbst richtete und andere Gefühle wie Trauer, Verzweiflung, Hass und Angst krampfhaft unterdrückt hatte. Essen half dabei, ebenso wie dauernde Ablenkung durch einen vollgepackten Terminplan. Immer darauf bedacht, möglichst viele «Erfolge» zu feiern.
Ich verstehe heute, dass ich in so vielen Situationen meines Erwachsenenlebens durch Trigger direkt in meine Kindheit zurückkatapultiert werden konnte. Und immer noch werden kann. Wie meine Mutter mit uns gesprochen hat, so tönt meine autoritäre Stimme in meinem Kopf. Die Stimme, die mich fett, hässlich, unfähig, schwach und eine schlechte Mutter schimpft.
Sie bringt mich zurück dahin, wo meine Mutter mich nicht ein einziges Mal umarmt oder getröstet hat. Wo mein Vater durch einen Schicksalsschlag krank wurde und danach ein anderer war. Kein Vater mehr, mehr so ein waberndes Etwas, das nach sich selbst suchte. Und sich schon gar nicht zwischen mich und meine narzisstische Mutter gestellt hätte.
Rückblickend gesehen, taumelte ich durchs Leben. Halt fand ich erst, als ich vor sieben Jahren meinen Mann kennengelernt hatte. Mein Mann ist ein unheimlich authentischer, klarer und ehrlicher Mensch. Pragmatisch sucht er nach Lösungen und vertraut darauf, dass alle alles erreichen können. Erst durch seinen Halt und seine Liebe wurde mir klar: Ich möchte eine eigene Familie gründen, aber keiner weiteren Generation diese Last aufbürden.

***
Zu meinen Eltern habe ich sporadisch Kontakt, halte sie aber auf Abstand. Zu dem Zeitpunkt, als eine Aussprache realistisch geworden wäre, sind beide innerhalb weniger Monate schwer erkrankt und nicht mehr dieselben. Sie möchten nun gern Grosseltern sein und bemühen sich in ihrem Rahmen, aber ihre blosse Präsenz raubt mir noch immer viel Energie. Mein Kind darf seine Grosseltern kennenlernen und später selbst entscheiden, wie viel Kontakt es haben möchte.
Heute geht es mir nicht zuletzt dank Therapie gut und ich kann mit deutlich mehr Energie und Freude den Mutteralltag bewältigen. Ich fühle mich nicht mehr kraftlos und verzweifelt und beginne das Leben mit unserer Tochter sogar sehr zu geniessen. Ich liebe es, ihre Fortschritte und ihren Entdeckergeist zu beobachten und freue mich manchmal nachts sogar, wenn sie schreit. Denn: Wie lange ist diese Zeit schon?
Und es ist verrückt, erst jetzt kann ich etwas, das mir trotz aller Therapie vorher nie gelungen ist: Meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle wirklich ernst nehmen und einfach mal so stehen lassen. Ich sehe allmählich, was genau dieses (Co-)Regulieren und aushalten mit meiner Tochter macht und was für ein Urvertrauen sie zu mir entwickelt.
So kann ich mir endlich zugestehen, dass auch ich mal unzufrieden, erschöpft und ratlos sein darf. Und ich sehe es als meine Pflicht, dazu zu stehen, zu verbalisieren und mir dann Gutes zu tun. Wie sonst sollte mein Kind lernen, dass es wirklich in Ordnung ist, schwierige Gefühle zu haben?
Ich glaube, unter dem Strich bin ich eine genau so gute Mutter wie andere. Es geht für mich weder darum, dass ich krampfhaft meine eigene tragische Kindheit quasi am «Modell» mit meiner Tochter kompensiere, noch dass ich alles so mache, wie ich es erlebt habe. Die Realität liegt irgendwo zwischen den zwei Polen und ich würde mir niemals anmassen, dass unser Kind mich vergöttern müsste, nur weil ich mir Gedanken darüber mache, wie sie aufwächst und was ihre Bedürfnisse sind.
Sie darf meine Fehler sehen, über meine Schrulligkeit lachen und auch mal sagen «Mama, so nicht».
Sie darf Fehler machen, zweifeln und hadern und sich mal absolut daneben benehmen. Ich werde da sein, ihr Wurzeln bieten, an denen sie sich im Sturm festhalten kann.
Und eigentlich habe ich als Mutter bloss zwei Wünsche:
Ich hoffe, dass du, meine Tochter, auch als erwachsener Mensch noch zu mir kommst mit deinen Anliegen – im Wissen darum, dass du bei mir stets gehalten wirst.
Ich wünsche dir, mein Mädchen, dass du später einmal in den Spiegel blickst und magst, was du siehst und innerlich fühlst. Mögen dein wacher Blick, dein freimütiges und offenes Herz, dein gewinnendes Lachen und deine klare Art, dich auszudrücken stets deine Begleiter sein. Denn so wie du bist, bist du gut genug.
Informationen zum Beitrag
Dieser Beitrag erschien erstmals am 8. Oktober 2022 bei Any Working Mom, auf www.anyworkingmom.com. Any Working Mom existierte von 2016 bis 2024. Seit März 2024 heissen wir mal ehrlich und sind auf www.mal-ehrlich.ch zu finden.
1x pro Woche persönlich und kompakt im mal ehrlich Mail.








