Ableismus: Wie begegnen wir Kindern mit einer Behinderung?
Das Thema Behinderung betrifft uns alle, denn niemand ist davor gefeit. Doch was können wir im Alltag konkret tun gegen Ableismus und für mehr Inklusion? Wir haben bei Familien mit einem Kind mit einer Behinderung nachgefragt.

«Mami, wieso hat das Mädchen nur eine Hand?», fragte mich mein damals vierjähriger Sohn in der Badi und zeigte auf ein Kind, das ein paar Meter entfernt im Wasser spielte. Ich muss zugeben, die Frage hat mich aus dem Konzept gebracht. Wie sollte ich in dieser Situation richtig reagieren? Obwohl ich selbst ein Kind mit einer Behinderung habe, wusste ich es nicht, war unsicher. Ich antwortete meinem Sohn, dass ich es nicht wisse, dass das Mädchen aber offensichtlich viel Spass beim Baden habe – genauso wie er.
Ich wollte noch mehr erzählen, weiter ausholen, wollte meinem Sohn vermitteln, dass eine Behinderung zwar einschränken kann, dass sie einen Menschen aber nicht ausmacht. Ich wollte betonen, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt, wollte von Inklusion sprechen. Doch da war er schon verschwunden und hatte sich zu dem Mädchen aufs Schaumstoff-Floss gesellt. Diese Situation hat mir gezeigt:
Kinder stellen Unterschiede zwar fest, aber im Gegensatz zu uns Erwachsenen bewerten sie diese nicht.
Wir Erwachsenen hingegen – ich eingeschlossen – tun uns oft schwer im Umgang mit Menschen, die nicht der sogenannten «Norm» entsprechen. Nicht aus Bosheit, vielmehr aus Unsicherheit oder schlicht und einfach, weil wir so sozialisiert worden sind. Das führt zu verschiedenen Formen von Diskriminierung – zu Rassismus, Sexismus, Klassismus oder eben zu Ableismus.
Ableismus (von engl. able = fähig) ist eine Form der Diskriminierung, die Menschen mit Behinderungen betrifft und sie sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene benachteiligt. Sie beruht auf der Annahme, dass Menschen mit Behinderung weniger körperliche und/oder geistige Fähigkeiten und damit auch weniger Wert haben als nicht-behinderte Menschen. Das führt zu Ungleichbehandlung, gesellschaftlicher Benachteiligung und Ausgrenzung und ist eines der grössten Hindernisse auf dem Weg zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft.
Rund 1,7 Millionen Menschen leben in der Schweiz mit einer Behinderung (Zahlen des Bundesamts für Statistik), das ist rund ein Fünftel der Bevölkerung. Ich benutze in diesem Beitrag bewusst die Wörter Behinderung und behindert, welche viele Betroffene als neutrale Selbstbezeichnung wählen. Weil diese Begriffe jedoch auch als Schimpfwörter missbraucht werden und deshalb einen negativen Beigeschmack haben können, fühlen sich manche betroffene Menschen damit nicht wohl und bezeichnen sich selbst lieber anders – das gilt es in jedem Fall zu akzeptieren. Mehr zu dieser Thematik gibt es auf Instagram bei @luisalaudace oder in der Video-Reihe «Redeweise» der Aktion Mensch.
Einige Formen von Behinderung sind sichtbar, andere nicht. Auch die Herausforderungen, die sie mit sich bringen, sind unterschiedlich. Gemäss einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes sind nur etwa drei Prozent der schweren Behinderungen angeboren oder treten im ersten Lebensjahr auf. Die meisten werden im Laufe des Lebens erworben, sei es durch einen Unfall, eine Krankheit oder den natürlichen Alterungsprozess. Und auch darum geht uns das Thema alle etwas an:
Niemand ist vor einer Behinderung gefeit.
Es könnte jede:n von uns treffen – auch unsere Kinder. Morgen, nächstes Jahr oder auch erst im Alter. Würden wir uns nicht spätestens dann eine inklusivere Gesellschaft wünschen, die Menschen nicht in fähig und nicht-fähig unterteilt? Um dorthin zu gelangen, müssen wir uns unserer Vorurteile bewusst werden, Berührungsängste abbauen und aktiv gegen Ableismus vorgehen.
Ich habe bei sechs Familien mit einem Kind mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung nachgefragt, welche Erfahrungen sie im Alltag machen und was sie sich von der Gesellschaft im Umgang mit ihren Kindern und ihnen als ganze Familie wünschen würden.
Wie so oft im Leben gilt: Ein Patentrezept gibt es nicht! Weil Behinderung nicht gleich Behinderung ist. Und Mensch nicht gleich Mensch. Persönliche Ressourcen können unterschiedlich sein. Selbst auf die Tagesform kann es ankommen. Umso mehr braucht es Offenheit, Empathie, Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kindern mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung und ihren Familien.
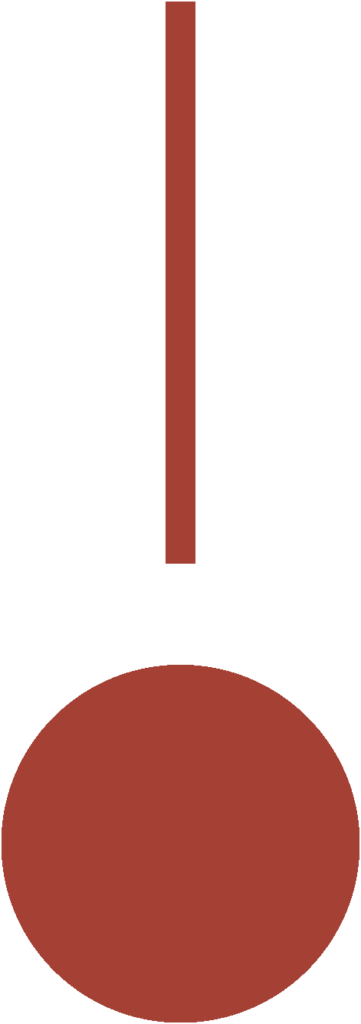
Wir werden diesen Beitrag noch aufbretzeln für unsere neue Webseite. Drum sieht momentan nicht alles rund aus. Aber mal ehrlich: gut genug. Danke für deine Geduld!
Melanie G.: «Wir brauchen weder Mitleid noch riesige Plüschelefanten»
Immer mal wieder kommt es vor, dass wildfremde Leute auf der Strasse oder im Bus unserem elfjährigen Sohn Jorim Süssigkeiten schenken – Schöggeli, Zältli, ein Päckli Smarties. Jorim wurde mit einem seltenen Gendefekt geboren. Er hat eine geistige Behinderung und sitzt im Rollstuhl. Einmal, an der Chilbi – er war damals etwa zehn Jahre alt – ist ein Paar auf uns zugekommen mit einem riesigen Plüschelefanten, sicher einen Meter gross, den sie zuvor an einem der Stände gewonnen hatten. «Wir haben euch vorhin schon gesehen und möchten eurem Sohn diesen Elefanten schenken», sagten sie. Ich war perplex und wusste in dem Moment nicht, wie ich reagieren sollte.
Natürlich war es gut gemeint und Jorim freute sich, so dass wir das überdimensionale Plüschtier schlecht ablehnen konnten. Doch das Geschenk hatte einen faden Beigeschmack. Die nett gemeinte Geste fühlte sich für uns nach Mitleid an – und Mitleid braucht unser Sohn nicht. Er ist ja nicht krank, er leidet nicht. Er ist einfach so, wie er ist. Auch gegenüber unserer dreieinhalb Jahre jüngeren Tochter ist es schwierig zu erklären, wieso ihr Bruder Süsses und Geschenke kriegt und sie leer ausgeht.
Mit einem Kind im Rollstuhl steht man in vielen Alltagssituationen automatisch im Mittelpunkt. Einerseits verstehe ich, dass die Leute hinschauen, andererseits würde ich gerne mehr in der Masse untergehen statt immer hervorzustechen. Jorim selbst scheint das nicht wahrzunehmen – oder es stört ihn einfach nicht. Mir jedoch ist es unangenehm, wenn wir angestarrt werden.
Auch explizites Anlächeln kann sich bemitleidend anfühlen.
Da ist es mir lieber, wenn uns jemand direkt anspricht, Fragen stellt und Interesse zeigt. Doch ich merke, dass Erwachsene in dieser Hinsicht viel gehemmter sind als Kinder.
«Mami, wieso ist der Bub im Rollstuhl?» Nach meiner Erfahrung gehen Kinder sehr offen mit Behinderung um und sind interessiert. Schwierig finde ich es, wenn die Eltern dann peinlich berührt und abwehrend reagieren und versuchen, ihr Kind mit lautem «Psssscht»-Gezische zum Schweigen zu bringen. So als ob man über dieses Thema nicht sprechen dürfte. Oder mutmassen und beschönigende Antworten geben wie: «Vielleicht hat er ein Bein gebrochen.» Mir ist es lieber, wenn sie ihr Kind zum Nachfragen ermuntern. Ich kann dann ja immer noch sagen, wenn ich grad nicht erklären mag.
Jüngeren Kindern sage ich jeweils, dass Jorim zu wenig Kraft in den Beinen hat; unter einem seltenen Gendefekt können sie sich nämlich wenig vorstellen. Ich sage ihnen auch, dass er nicht krank ist und ihm nichts weh tut, dass er ihnen also nicht leid tun muss. Einmal haben wir eine Situation im Sandkasten erlebt, in der Jorim auf ein jüngeres Kind zugekrochen ist, um mit ihm zu spielen. Das Kind ist etwas zurückgewichen, worauf die Mutter zu ihm gesagt hat: «Du musst keine Angst haben vor ihm.» Für mich fühlte sich das so an, als ob sie über meinen Sohn sprechen würde wie über einen Hund, der vielleicht beissen könnte. Es zeigte mir einmal mehr, dass ein Kind mit einer Behinderung in der Gesellschaft nichts «Normales» ist.
Jorim hat seinen Rollstuhl mit etwa vier Jahren bekommen. Und auch wenn wir im Alltag oft auf Hindernisse stossen, war er für uns eine Vereinfachung, denn er machte Jorims Behinderung für die Gesellschaft offensichtlicher. Zuvor, als er noch im Buggy sass, ernteten wir manchmal abschätzige Blicke und Kommentare. Einmal sagte eine Mutter beim Einkaufen für uns gut hörbar zu ihrem Kind: «Das grosse Kind da könnte also auch selber laufen.» Solche unüberlegten Kommentare taten weh. Wenn wir heute mit dem Rollstuhl unterwegs sind, erleben wir zum Glück viel Hilfsbereitschaft.
Den Satz «Ich könnte das nicht» höre ich nicht gerne. Ich habe mir die Behinderung unseres Sohnes ja auch nicht ausgesucht. Ich habe keine Wahl, ich muss einfach können. Durch ein Kind mit einer Behinderung wird man sensibler, was Sprache angeht. Es macht einen Unterschied, ob jemand sagt «ein behindertes Kind» oder «ein Kind mit einer Behinderung».
Jorim hat eine Behinderung, er ist nicht seine Behinderung. Und er wird behindert – in vielen alltäglichen Situationen.
Etwa, wenn es bei einer Treppe zwar eine Rampe gibt, die aber viel zu steil ist, als dass Jorim selbst hinauf- und hinunterfahren könnte. Wenn ein Gebäude zwar mit Lift ausgerüstet ist, die Türen aber von Hand geöffnet werden müssen. Oder wenn die Holzschnitzel auf dem Spielplatz, die als Fallschutz dienen, ein unüberwindbares Hindernis für ihn darstellen.
Sarah: «Die Diagnose meines Kindes ist kein Smalltalk-Thema»
Meine dreijährige Tochter reisst ihre Augen auf und ihre Arme in die Luft. Ihr Mund öffnet sich etwas, dann sinken die Arme wieder auf die Armlehnen ihres Rollstuhls zurück. «Was hat sie denn?» fragt die ältere Frau mich, im selben Gang der Drogerie stehend. «Vielleicht hat sie sich erschrocken», antworte ich knapp, denkend, dass Romy wahrscheinlich eher einen kurzen Krampfanfall hatte. Denkend, dass ich das nicht erklären möchte. Dabei ahne ich, dass dies nicht die letzte Frage sein wird, denn ich sehe, dass die Person noch weiter schaut.
«Und was hat sie wirklich?», fragt die Frau. «Wie meinen Sie das?», frage ich zurück und weiss verdammt genau, wie sie es meint. «Ja, weil sie im Rollstuhl sitzt. Und das Kabel an ihr dran ist.» Ich merke, dass ich verärgert bin. Könnte ich nun zurückfragen, was sie das angeht? Kann ich nicht. Nicht, ohne dabei respektlos zu erscheinen. Ich kann mich fragen, warum mich das Fragen stört. Ihr Ton und Blick waren schliesslich freundlich.

Diese Frage, die nicht gestellt würde, wäre da nicht ein vermeintlicher Anspruch auf eine Antwort. Ich habe mal gedacht, Interesse wäre etwas Positives. Das Interesse dieser Frau kann jedoch auch meinen: «Dieses Kind kann nicht nichts haben.» Gewiss kann ich antworten, dass die Geschichte und Diagnose meines Kindes diese Person, der ich beim Einkaufen erstmalig und letztmalig über den Weg laufe, nichts angehen. Weil das nichts Beiläufiges ist, nicht Smalltalk ist, nicht Einstieg ist. Weil es privat ist, verletzlich ist, viel ist. An meinem emotionalen Stress wird das jedoch nichts mehr ändern.
Tatsächlich habe ich gesagt, dass mein Kind einen Sauerstoffmangel unter der Geburt erlitten hat. Obwohl ich gar nicht darüber reden wollte. Zurückgeblieben ist die emotionale Aufgewühltheit.
Die Sache ist: Warum frage ich das eine Person, die ich nicht kenne?
Diese Frage nach Diagnosen ist für mich weder ein geeigneter Gesprächseinstieg noch eine Information, auf die ein Anspruch besteht.
Nicht jede fragende Person möchte ausgrenzen. Doch wahrscheinlich ist da Interesse, weil meine Tochter auffällt. Sie fällt auf, weil da eine Norm in der Vorstellung ist, in der meine Tochter unberücksichtigt ist. Solche Aussagen sind vielleicht nicht böse gemeint, aber dennoch übergriffig. Impact over Intent.
Was die Frau stattdessen hätte machen können? Schauen ist nicht grundsätzlich schlimm, wenn es nicht anhält und zu Starren übergeht. Lächeln ist okay, so wie man auch andere Kinder anlächelt. Nichts sagen ist wirklich nicht schlecht.
Diese Situation ist mir mit Kind vor über einem Jahr passiert. Müsst ihr auch an die Frage «Woher kommst du wirklich?» im Rassismus-Kontext denken? Diskriminierende Muster ähneln sich, haben Schnittstellen. Meine Tochter hat keine rassistische Diskriminierung erfahren, andere Personen werden mehrfach diskriminiert. Es bringt uns nicht weiter, gegen die eine Diskriminierung zu sein und andere unkommentiert zu lassen.
Diesen Text hat Sarah verfasst. Sie hat ihre Tochter vier Jahre lang gepflegt, bis zu Romys Tod im Dezember 2022. Mehr von Sarah könnt ihr auf ihrem Instagram-Profil @phyxchen lesen.
Werbung für unsere Partnerin Barbie

Unsere Kooperationspartnerin Barbie engagiert sich für mehr Vielfalt und Inklusion im Spielzeugregal. Das Unternehmen ist sich der Bedeutsamkeit von Repräsentation bewusst und setzt sich dafür ein, die nächste Generation zu inspirieren – ein wichtiges Anliegen auch für uns, gerade wenn es um die Themen Behinderung und Inklusion geht.
Diverses Spielzeug hat in unseren Augen zwei grosse Benefits: Einerseits gibt es Kindern mit einer Behinderung eine Identifikationsmöglichkeit und ein Zugehörigkeitsgefühl. Andererseits macht es das Thema Behinderung auch für Nicht-Betroffene sichtbarer und zeigt Kindern, dass alle dazugehören. Das Spielen mit Puppen, die nicht der eigenen Lebenserfahrung entsprechen, kann Verständnis wecken und Empathie fördern – was schliesslich zu einer toleranteren Gesellschaft führt.
Die Barbie-Fashionista-Reihe ist die vielfältigste und inklusivste Puppenserie auf dem Spielzeugmarkt. Die Puppen haben eine Vielzahl von Körpertypen, Hautfarben und Frisuren, sitzen im Rollstuhl, tragen Prothesen oder Hörgeräte. Im Frühling 2023 wurde die Reihe durch eine Barbie mit Down-Syndrom erweitert.

Andrea*: «Ich kann und will die Emotionen von Fremden nicht abfangen»
Als Reaktion auf Noras* Behinderung erfahren wir oft Mitleid. Sehr viel Mitleid. Nora ist vier Jahre alt, sehr fröhlich, kontaktfreudig und total offen. Ausserdem ist sie praktisch seit Geburt blind. Immer mal wieder kommt es vor, dass andere Menschen – auch fremde – Tränen in den Augen haben, wenn sie von ihrer Blindheit erfahren. «Oje, das arme Kind!» oder «Das tut mir so leid!» haben wir schon so oft gehört.
Und dann tut mir mein Kind leid, dass es sich das anhören muss, obwohl es sich selbst gar nicht leid tut.
Blindheit scheint von vielen als etwas sehr Schlimmes und Trauriges wahrgenommen zu werden. Auf einem Weihnachtsmarkt war Nora einmal völlig unbeschwert und fröhlich damit beschäftigt, Eindrücke zu sammeln, als jemand im Vorbeigehen laut sagte: «Das arme Kind. Das tut mir im Herzen weh, dass sie all die schönen Lichter nicht sehen kann.» Absichtlich hörbar für uns. Was soll das? Soll ich mich dadurch besser fühlen?
Ich weiss, die Leute sind wirklich ehrlich betroffen, aber es war und ist für mich schwierig, auf solche Mitleidsbekundungen zu reagieren. Ich kann und will die Emotionen von Fremden nicht abfangen. Am Anfang, als wir die Diagnose erhielten, musste ich selbst damit fertig werden, da war es sehr, sehr schwer, auch noch die Trauer oder eben das Mitleid anderer zu ertragen. Mittlerweile geht das besser. Ich antworte jeweils, dass Nora kein Mitleid nötig hat, wir auch nicht. Es geht ihr und uns sehr gut.
Wenn wir mit Nora unterwegs sind, fallen wir auf. Viele Leute können wahrscheinlich fast nicht anders, als hinzuschauen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ein Kind mit Langstock sieht man selten. Manchmal macht es mir nichts aus, ich bin stolz auf Nora und will sie nicht verstecken. Andere Male empfinde ich es als unhöflich und unangenehm. Wenn ich dann Blickkontakt aufnehme, wird es der Person meist bewusst, dass sie starrt, und sie schaut weg.
Zum Glück gibt es viele positive Begegnungen, bei denen die Behinderung nicht im Vordergrund steht, sondern Nora. Als Kind, als Person, als Nora eben. Das durften wir in der Natur-KiTa in unserem Dorf erfahren, als unsere Tochter mit den sinngemässen Worten «Ja, wieso nicht? Wir haben zwar keine Erfahrung, aber wir probieren’s mal.» aufgenommen wurde. Es hat wunderbar geklappt, dank des Engagements des Teams. Ebenso in der regulären Spielgruppe, die sie mit Assistenz besuchen konnte. Die Spielgruppenleiterin meinte: «Nora ist einfach Nora. Sie ist einfach ein Kind, das halt nichts sieht.» Im Schuhgeschäft erhält sie, ohne Zögern und ohne Hemmungen, eine umfassende Beratung inklusive der Frage: «Welche Farbe gefällt dir denn besonders gut?» Da würden viele nicht mal auf die Idee kommen, dass auch ein blindes Kind Lieblingsfarben hat.
Schwieriger wird es beispielsweise in Bücherläden, Bibliotheken und Museen. Taktil illustrierte Bilderbücher kosten gut 80 Franken pro Stück. Wir können nicht einfach im Büchergeschäft stöbern und schöne Bilderbücher aussuchen. Das ist schade. In Museen darf oft nur wenig angefasst werden. Es gibt zwar teilweise Führungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, diese sind jedoch meist auf Erwachsene ausgerichtet und es braucht eine Voranmeldung. Hier gäbe es noch viel Spielraum für mehr Inklusion.
Wir werden regelmässig gefragt: «Sieht sie gar nichts?» Das finde ich meist okay. Denn es hilft dem Gegenüber, die Situation und unsere Tochter einzuschätzen. Wenn ich mit Nora in der Stadt unterwegs bin, bin ich wirklich stolz auf sie – wie gut sie ihren Langstock schon einsetzt, wie aufmerksam sie ihre Umgebung wahrnimmt, wie sie sich dank Echolokalisation schon relativ sicher bewegen kann. Sie gibt mit ihrer Zunge Klick-Geräusche von sich und kann so mit Hilfe des Echos hören, wo Wände, Bäume oder sonstige Hindernisse sind.
Natürlich stösst Nora an Grenzen im Alltag. Sich zu orientieren ist für sie viel schwieriger als für Sehende. Sie kann sich keinen Überblick verschaffen, sondern muss beispielsweise einen Raum Stück für Stück erforschen. Doch das macht sie mit grossem Gwunder. Es ist gut, wenn man ihr Zeit lässt.
Schade finde ich, dass Nora oft weniger zugetraut wird als gleichaltrigen sehenden Kindern.
Beispielsweise, dass sie selber ihre Schuhe an- und ausziehen kann. Sie wird oft an der Hand genommen und geführt, weil viele annehmen, dass sie sich nicht selbstständig fortbewegen und orientieren kann. Dabei ist es im Umgang mit einem blinden Kind sehr wichtig, dass man es eben nicht einfach ungefragt führt, an der Hand nimmt und vor allem nicht einfach die Hand des Kindes auf etwas drauflegt. Das ist sehr übergriffig. Das Kind muss selbst entscheiden können, ob es etwas berühren will oder nicht.
Besser ist es, wenn man zuerst fragt und Hilfe anbietet. Falls Hilfe gewünscht ist, kann man das Kind am Ellbogen führen, so dass es die Kontrolle über seine Hand behält.
Manchmal wäre ich extrem froh, wenn uns jemand Hilfe anbieten würde – beispielsweise beim Ein- und Aussteigen in den Zug oder Bus. Wenn ich mit Nora und ihrem kleinen Bruder im Kinderwagen unterwegs bin, gebe ich ihr extra den Langstock, damit die Leute sehen und berücksichtigen, dass sie blind ist. Aber in den wenigsten Fällen bietet mir jemand an, mit dem Kinderwagen zu helfen oder Nora kurz zu halten.
Andere Kinder sind im Umgang mit Nora oft neugierig. Aber auch verunsichert, weil sie nicht richtig einschätzen können, was da los ist. Es hilft, wenn sie durch Erwachsene begleitet werden, die ihnen die Situation erklären. So können Hemmschwellen abgebaut werden. Es gibt Kinder, die sofort mit Nora spielen, als wäre ihre Blindheit nichts Besonderes. Andere übernehmen eher eine bemutternde Rolle, was Nora manchmal auch geniesst. Wieder andere wollen nichts mit ihr zu tun haben und gehen auf Distanz. Das ist okay, nicht jedes Kind muss mit jedem Kind klarkommen.
Mit dem Begriff Behinderung habe ich kein Problem. Er ist für mich nicht negativ behaftet. Für Nora auch nicht. Für sie ist es eher wie eine Eigenschaft, die zu manchen Menschen gehört. Wie das Alter oder die Haarfarbe. Sie fragt danach, wie nach dem Namen. Ohne Wertung. Das wünsche ich mir auch von anderen Menschen. Dass unser Kind als Kind wahrgenommen wird und ihre Behinderung nicht zu stark im Fokus steht.
*Andrea und Nora heissen in Wirklichkeit anders.
Yvonne und Markus: «Wir wünschen uns, dass alle Menschen gleichbehandelt werden»
Flurin ist es bereits mit seinen drei Jahren bewusst, dass er anders ist und dass er nicht laufen kann wie seine Gspänli im gleichen Alter. Mit seinem manuellen Rollstuhl, den er ein paar Monate vor seinem zweiten Geburtstag erhalten hat, ist er sehr selbstständig unterwegs. Wir erleben viele positive Reaktionen. Flurin wird direkt angesprochen und gelobt, wie gut er mit dem Rollstuhl fährt und wie toll die Räder leuchten. Oft wird er auch auf seine strahlend grossen blauen Augen angesprochen.
Natürlich gibt es auch andere Reaktionen.
Diese Blicke reichen von Neugier über Irritation bis zu Unsicherheit.
Manchmal kommt es auch vor, dass Erwachsene den Blickkontakt vermeiden und sich abwenden, aber das ist eher selten. Kinder reagieren meist neutral und stellen Fragen. Das Wort «Behinderung» hören wir nicht gern und verwenden selbst den Ausdruck «körperliche Beeinträchtigung» oder «hat SMA Typ 2, eine seltene Muskelkrankheit».
Inklusion erleben wir als Win-win-Situation für alle Beteiligten. In der Spielgruppe und in der KiTa, in die Flurin geht, integrieren ihn die anderen Kinder im Alltag sehr, sind äusserst hilfsbereit und vermissen ihn sofort, wenn er nicht da ist. Alle Beteiligten können sehr von Flurins Muskelkrankheit profitieren und lernen rasch, damit umzugehen. Die Eltern haben da oftmals mehr Mühe. Auffallend ist jedoch, dass Flurin auch bei ihnen bestens bekannt ist – ein Zeichen, dass die Kinder zu Hause von Flurin erzählen.
Wir wünschen uns, dass alle Menschen gleichbehandelt werden. Dass unser Sohn trotz seiner körperlichen Beeinträchtigung dieselben Rechte hat und inkludiert wird. Öffentliche Gebäude, insbesondere Schulen, müssen barrierefrei werden. Generell braucht es mehr Offenheit, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter allen Menschen.
Denise: «Von Inklusion können alle Seiten profitieren»
Meine Lieblingsgeschichte ist die mit dem Bauern: Yanik haut ab, mitten durch die hohe Wiese und das tütschgelbe Rapsfeld, ich hinterher. Der Bauer wettert übelst übers ganze Feld, wirft mit Schimpfwörtern um sich. Yanik springt immer weiter hinein, ich kann ihn nicht davon abhalten. Genügend nah dann die lautstarke Erkenntnis des Bauern: «Aha… er ist behindert!»
Meine Antwort? «Sie allem Anschein nach auch, so wie Sie mit uns kommunizieren.» Das hat sich sehr befreiend angefühlt. Und ich habe über mich selbst gestaunt, dass ich die Stärke hatte, ihm diese Worte um die Ohren zu hauen. Cool war, dass wir beim anschliessenden kurzen Gespräch gegenseitig grosses Verständnis füreinander hatten und uns entschuldigt haben. So wünschten wir uns danach einen schönen Tag und zogen alle von dannen.
Ich denke, die Situation bleibt für beide Seiten unvergessen und hat unseren Horizont erweitert. Ich habe verstanden, was den Bauern so sehr verärgert hat, dass er Angst um seine Ernte hatte, weil es offenbar tatsächlich Leute gibt, die absichtlich seine Felder niedertrampeln. Und er hat gelernt, dass nicht immer eine böse Absicht hinter dem Handeln eines Menschen stecken muss.
Dass man manchmal zuerst genauer hinschauen sollte, bevor man urteilt oder gar eingreift.
Yanik ist zehn Jahre alt und ist von einer Mehrfachbehinderung betroffen. Er hat unter anderem eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS), Epilepsie und Entwicklungsauffälligkeiten. Von Weitem sieht man ihm seine Behinderung nicht an, aber von Nah bemerken es die Leute relativ rasch und nehmen normalerweise Rücksicht und haben Verständnis – oder tun wenigstens so als ob.
Wir sind sehr dankbar, dass wir in einer ländlichen Gegend wohnen. Hier erleben wir kaum direkten Ableismus. Das Dorf ist überschaubar, man kennt Yanik und seine riesige Freude an Türen jeglicher Art – am liebsten elektrische. Wenn wir im Dorfladen sind, «muss» auffällig oft jemand vom Ladenpersonal noch schnell etwas im Lager holen und Yanik darf die sich öffnende und schliessende Tür zum Lager bestaunen. Bei der Kasse wartet das spannende Förderband auf ihn und – obwohl wir keine Raucher sind – öffnet und schliesst sich das Fach für Alkohol und Tabakwaren ein paarmal für unseren strahlenden Sohn.
Yanik ging von klein auf an einem Tag pro Woche im Dorf in den Regelkindergarten und später in die Regelschule. Diese Teilintegration brauchte und braucht immer wieder viel Einsatz und Eigeninitiative von uns Eltern, aber es lohnt sich. Heute ist Yanik in der 5. Klasse. Für ihn ist dieser Tag ein super Übungsfeld. Er lernt, sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden, die für Autisten und Autistinnen viele Herausforderungen bereithält. Yaniks Mitschüler:innen, Lehrer:innen und die anderen Eltern lernen, mit seinen Besonderheiten umzugehen. Es war und ist für mich sehr beeindruckend, wie die Kinder ihn immer völlig selbstverständlich angenommen haben, ganz ohne Berührungsängste, auch wenn er anfangs kaum ein Wort sprach.
Vom Umgang der Kinder mit unserem Sohn könnten sich so manche Erwachsene eine Scheibe abschneiden.
In meinen Augen gibt es schon viele Menschen, die mega offen und tolerant mit Menschen mit einer Behinderung umgehen. Aber es gibt auch immer noch sehr viele, die überfordert und unsicher im Umgang sind. Ich glaube, alle Menschen in ihrer ganzen Vielfalt an Beeinträchtigungen sowie vermeintlich neurotypische tun einander gut. Deshalb setze ich mich seit vielen Jahren für Inklusion ein. Denn davon können alle Seiten profitieren.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Inklusion aller Verständnis füreinander schafft und Hemmungen im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung abbaut. Deshalb wünsche ich mir, dass Menschen mit Behinderung noch mehr in der Gesellschaft sichtbar werden. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen eine Beeinträchtigung haben in der Schweiz, sieht man immer noch sehr wenige direkt auf den Strassen oder an Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Deshalb bin ich mit Yanik gerne unterwegs, mitten in der Gesellschaft, und wirble manchmal das normale Treiben etwas auf. Oft müssen die Leute schon etwas schauen und staunen, wenn Yanik halt ein bisschen lauter und «anders» ist. Ja, ich nehme die Blicke von Fremden als Staunen wahr und nicht als Starren. Die Leute sind verwundert, irritiert, manchmal auch etwas überfordert, aber ich verbuche das nicht als negative Aufmerksamkeit.
Ich sehe das als eine Art «Entwicklungshilfe» für die Gesellschaft. Denn indem die Leute hinschauen, werden sie auch mit dem Thema Behinderung konfrontiert. Und genau diese Sichtbarkeit und Durchmischung wünsche ich mir.
Melanie F.: «Worte sind Macht»
Emma ist fünf Jahre alt, hat blonde Haare, blaue Augen und eine Behinderung. Das darf man ruhig so sagen. Das Wort ist für mich vollkommen neutral. Sie hat keine «special effects» und auch keine «besonderen Bedürfnisse». Ihre Behinderung bemerkt man nicht auf den ersten Blick. Im Gegenteil: Sie bekommt regelmässig Komplimente für ihre schönen grossen Augen und ihr spezielles Gesicht. Tatsächlich werden die Gesichtszüge von Menschen mit dem Williams-Beuren-Syndrom (WBS) oft als elfen- oder koboldhaft beschrieben.
Dass man Emma ihre Behinderung nicht sofort ansieht, hat Vor- und Nachteile. Manchmal bin ich froh darum, weil Aussenstehende so zuerst den Menschen Emma sehen und nicht die Behinderung. Sie erfährt dadurch im Alltag weniger Diskriminierung. Auf der anderen Seite muss ich viel mehr erklären und ihr Verhalten rechtfertigen, wenn es nicht der «Norm» entspricht – wenn sie zum Beispiel laut kreischt, sich wegen ihrer Geräuschempfindlichkeit die Ohren zuhält oder mit den Händen wedelt, als wollte sie davonfliegen.
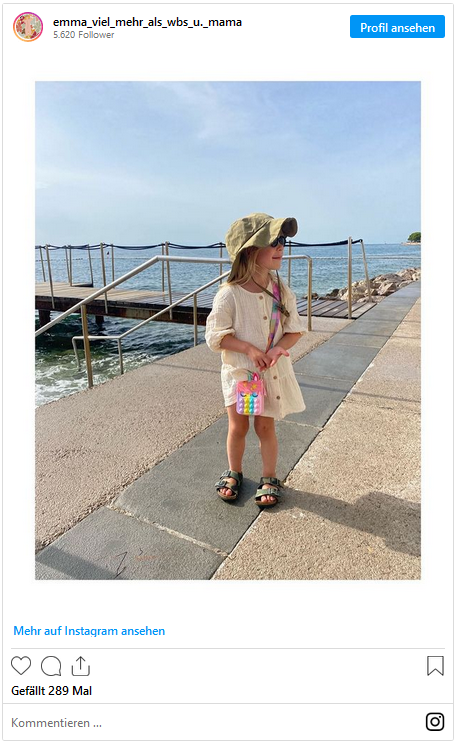
Das WBS ist ein seltener Gendefekt, bei dem auf dem Chromosom 7 mehrere Gene fehlen. Emma hat eine Lernbehinderung und auch körperliche Einschränkungen; ihre Entwicklung ist im Vergleich zu Gleichaltrigen verzögert. So konnte sie zum Beispiel mit zwei Jahren noch nicht laufen, sondern ist auf allen Vieren gehüpft wie ein Häsli. Von Aussenstehenden kamen oft Kommentare wie: «Oh, sie läuft aber spät.» Meine Standardantwort war: «Das liegt an ihrer muskulären Hypotonie, die sie wegen ihrer Behinderung hat.» Die Reaktionen darauf reichten von betretenem Schweigen über dahingestammelte Entschuldigungen bis zu schnellem Themenwechsel.
Lieber als Mitleid wäre mir gewesen, wenn das Gegenüber Interesse gezeigt und gefragt hätte: «Aha, was bedeutet das genau?»
Wir haben auch gleich nach der Diagnose – da war Emma sechs Monate alt – eine Nachricht an Verwandte und Freunde geschickt, die Situation erklärt und geschrieben, dass wir kein Mitleid wollen, aber sehr gerne Hilfe annehmen. Natürlich gab es trotzdem auch im Bekanntenkreis bestürzte Reaktionen. In den Köpfen vieler Menschen ist eine Behinderung leider immer noch ein Weltuntergang, ein behindertes Kind eine Last. Das war für mich gerade in der ersten vulnerablen Phase nach der Diagnose schwierig.
Genauso schwierig war und ist es, wenn Emmas Behinderung relativiert oder mir meine Belastung abgesprochen wird.
Natürlich haben andere Kinder auch ihre Probleme und Eigenheiten, aber halt nicht so viele auf einmal oder nicht so extreme. Wenn Emma beispielsweise beim Einkaufen von 0 auf 100 ausrastet und komplett eskaliert, will ich nicht hören: «Mein Kind ohne Behinderung kriegt auch einen Trotzanfall, wenn es im Laden das gewünschte Spielzeug nicht kriegt.» Das mag sein, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Stellt keine Vergleiche an, wenn ihr nicht selbst in der Situation seid!
Oder wenn ich erzähle, dass es mich frustriert, dass Emma keine weiten Strecken laufen mag. Dann wünsche ich mir keinen Trost à la «Das ist bei anderen 5-Jährigen auch so» oder noch schlimmer: «Sei froh, dass sie überhaupt laufen gelernt hat.» Dann will ich einfach eine Bestätigung, ein «Ich verstehe deine Frustration» oder ein Kopfnicken.
Man muss Emmas Behinderung nicht schönreden. Sie hat, was sie hat, und sie ist, wie sie ist.
Mir war und ist es extrem wichtig, dass man uns nicht anders behandelt als vor der Diagnose. Dazu gehört für mich auch, dass sich meine Freundinnen und Freunde weiterhin über ihre Probleme mit mir unterhalten – ohne Hemmungen zu haben oder zu denken: «Oh, ich kann das Melanie nicht sagen, ihre Sorgen sind ja grösser als meine.» Sehr viel Wert lege ich aber auf eine sorgfältige Wortwahl. Ich ertrage keine Gespräche mehr, in denen mein Gegenüber Beschimpfungen verwendet wie «mein behinderter Arbeitskollege» oder «Ich hatte so ein M*** als Kundin».
Auch bei schlechten Vergleichen höre ich nicht mehr zu. Eine damals sehr enge Freundin sagte nach der Diagnose von Emma zu mir, ich wisse ja, wie es sei, wenn das Leben nicht so nach Plan laufe. Ich hätte nun ein Kind mit einer Behinderung und sie zur Zeit keinen Job. Joah, einige Wochen später hatte sie wieder einen Job – und Emma hat ihre Behinderung immer noch.
Ich kommuniziere Emmas Behinderung lieber offensiv als defensiv und bin froh, wenn die Leute mich im Alltag ohne Hemmungen ansprechen – gerade auch andere Eltern oder ihre Kinder selbst, wenn sie durch Emmas Verhalten irritiert oder verunsichert sind.
Ich finde es wichtig, dass man die Kinder mit ihren Fragen zum Thema Behinderung nicht allein lässt, sondern sie mit für sie greifbaren Erklärungen abholt.
Wenn die Kinder verstehen, wieso Emma so ist, wie sie ist, dann reagieren sie darauf nach meiner Erfahrung mit Verständnis und Geduld statt mit Auslachen oder gar Ausgrenzen. Einem sechsjährigen Jungen aus der Nachbarschaft habe ich ihre Behinderung so vermittelt: «Wir haben alle in unserem Körper 23 dicke Bücher. Bei Emmas 7. Buch fehlen ein paar Seiten, die man nicht wieder reinkleben kann. Darum verhält sie sich vielleicht manchmal ungewohnt oder braucht mehr Zeit, um etwas zu lernen.»
Sehr gut zum Erklären finde ich auch das Kinderbuch «Himmelblau». Das habe ich auch dem Regel-Kindergarten geschenkt, in den Emma seit einem Monat geht, zusammen mit einer Puppe mit Down Syndrom.
Was ich mir von der Gesellschaft wünschen würde? Worte sind Macht. Was ihr sagt und wie ihr’s sagt, hat einen mega Impact.
Bitte denkt daran, dass ihr als Eltern das Vorbild eurer Kinder seid. Schreckt ihr nicht vor dem Thema Behinderung zurück, sondern geht offen damit um, so werden das auch eure Kinder tun. Zeigt und bringt euren Kindern bei, dass verschieden zu sein total okay ist! Emma kann von euren Kindern lernen und sie können auch vieles von Emma lernen. Ihr könnt euren Kinder sagen, dass sie sicher viele Gemeinsamkeiten mit Kindern wie Emma haben – Pukyfahren, im Wasser planschen, im Sandkasten spielen.
Vor allem versucht bitte, Wörter wie krank, falsch oder abnormal NICHT zu verwenden! Wer oder was ist schon normal?
Mehr von Melanie und ihrer Tochter Emma gibt’s auf dem Instagram-Account @emma_viel_mehr_als_wbs_u._mama.
Wer mehr über das Thema Ableismus lesen möchte, dem empfehle ich die Ausgabe 4/2021 des Magazins «Behinderung & Politik» von AGILE.CH: Ableismus – wenn Normvorstellungen diskriminieren.
Full Disclosure: Dieser Artikel wird unterstützt von unserer Kooperationspartnerin Barbie. Artikel wie dieser benötigen viel Zeit. Da wir unsere Inhalte kostenlos anbieten, sind wir auf Kooperationspartner:innen angewiesen. Barbie unterstützt uns seit mehreren Jahren und hilft mit, dass wir Texte veröffentlichen können, die unsere Leser:innen inspirieren und zum Nachdenken anregen. Dazu gehören: Wie beeinflussen Glaubenssätze dein Leben? oder Mein Kind, mein Vorbild: Eltern über die Stärken ihrer Teenager oder der Podcast mit Tanja Frieden: «Wir müssen den Zugang zu unserem Kompass lernen».

Dank ihres Sohnes mit Down Syndrom rennt sie manchmal barfuss durchs Dorf, watet bei Minustemperaturen durch einen Bach und springt über ihren eigenen Schatten.
Informationen zum Beitrag
Dieser Beitrag erschien erstmals am 28. September 2023 bei Any Working Mom, auf www.anyworkingmom.com. Any Working Mom existierte von 2016 bis 2024. Seit März 2024 heissen wir mal ehrlich und sind auf www.mal-ehrlich.ch zu finden.
1x pro Woche persönlich und kompakt im mal ehrlich Mail.








