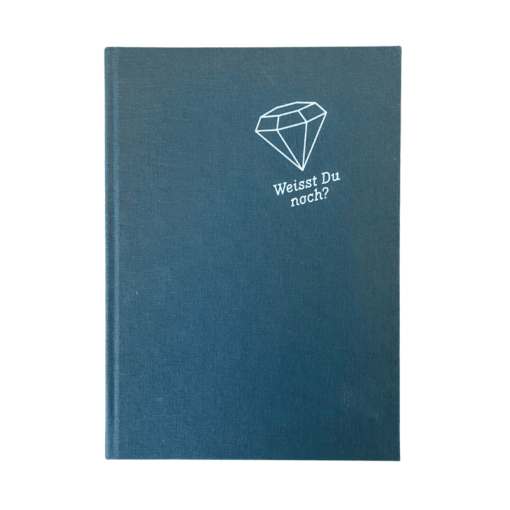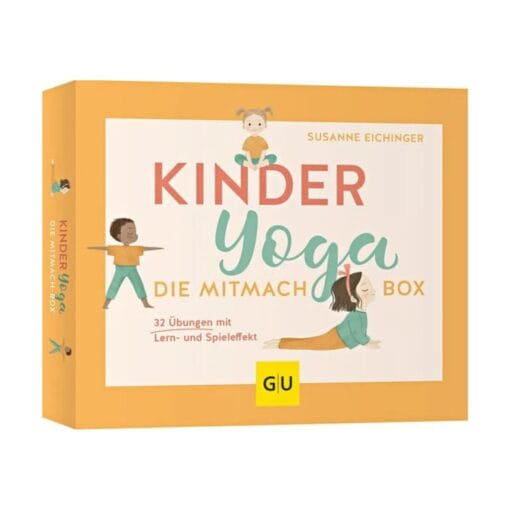Ennio geht – die Geschichte einer stillen Geburt
Barbara ist Ende dreissig, alleinstehend, mit Kinderwunsch. Dank einer Samenspende wird sie schwanger. Wenige Wochen vor der Geburt passiert das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann: Ihr Kind stirbt im Bauch.

Wie beginnt man eine Geschichte über das Traurigste, was einer Mutter passieren kann? Halt, sagt Barbara, da, man hört sie, wie sie Relativierung findet, wo es keine geben müsste. Halt. Für mich ist es das Traurigste, dass ich ein totes Baby gebären musste, ja. Schlimmer geht es einfach nicht. Aber ich stelle mir vor, wie es ohne Unterstützung gewesen wäre. Ohne mein Gerüst, das mich hält, immer hält.
Wie beginnt man eine Geschichte, für die es eigentlich keine Worte gibt, weil kein Wort der Welt an den Schmerz hinanreicht, den sie in sich trägt?
Man beginnt sie mit Liebe.
Zugewandtheit, bedingungslos
Barbara ist in der fünften Klasse im Skilager auf der Rigi. Sie hat starkes Heimweh, also machen ihre Eltern einen Ausflug ins Skigebiet und hinterlassen ihr eine Nachricht im Schnee. Barbara sieht den Gruss, aber statt sich darüber zu freuen, vermisst sie ihre Eltern umso mehr. Die Lehrerin ruft an, ihr Vater macht sich sofort auf den Weg, läuft mit den Langlaufski nach Rigi-Scheidegg und holt Barbara ab.
Barbara will ein solches Leben irgendwann auch eigenen Kindern ermöglichen, mit einem Partner an der Seite, die klassische Vorstellung.
Familie bedeutet für Barbara Zugewandtheit, bedingungslos. Wie sie es aus ihrem Elternhaus in einer kleinen Stadt im Kanton Bern kennt. Ruhige Strasse, freundliche Nachbarn, zum Znacht zu Hause sein, ansonsten frei. Sie ist ein quirliges Mädchen, gut vernetzt mit den anderen Kindern im Quartier. Barbara will ein solches Leben irgendwann auch eigenen Kindern ermöglichen, mit einem Partner an der Seite, die klassische Vorstellung. Eine Selbstverständlichkeit, denkt sie. Menschen machen das jeden Tag: sich verlieben, Kinder haben.
Aber der richtige Partner bleibt aus, keine Beziehung ist tragfähig genug für eine Familiengründung. Barbara geht offen damit um, auch mit ihrem Kinderwunsch, der immer mehr in den Vordergrund rückt, je älter sie wird.
Pragmatisch sein
Mit Ende dreissig weiss sie, dass sie alleine handeln muss. Es ist ein wohlüberlegter Entscheid, Barbara ist gut organisiert, hat alles gelesen, was sie zum Thema Samenspende finden konnte. Ihr Herzenswunsch, eine Familie mit einem Partner an der Seite zu gründen, ist nach wie vor da. Aber für den Moment, sagt sie sich, muss sie pragmatisch sein.
An einem Sonntag erzählt Barbara ihren Eltern, dass sie sich vorstellen kann, alleine ein Kind zu bekommen. Mit einer Insemination, bei der die Samen eines Spenders in die Gebärmutterhöhle übertragen werden. Barbara muss dafür nach Deutschland fahren, nach München, in eine Kinderwunschklinik. In der Schweiz ist gesetzlich klar geregelt, was eine Familie sein soll: Die Samenspende ist nur verheirateten Paaren erlaubt, seit Juli 2022 können auch lesbische verheiratete Paare die Samenspende in Anspruch nehmen. Aber alleinstehende Frauen nicht.
Die Eltern sind nicht überrascht, die Mutter findet es im ersten Moment trotzdem traurig. Dass ihre Tochter dieses Wagnis ohne Partner auf sich nehmen muss, macht ihr zu schaffen. Aber Barbara ist zuversichtlich. Sie weiss, dass sie gute Chancen hat. Sie ist gesund, hat ein unterstützendes Umfeld. Ihr Körper wird das packen und ihre Psyche auch.
Wie eine Zalando-Bestellung
An einem Montagmorgen im Juni 2021 fährt Barbara nach München. Ein Arzt empfängt sie, mit einer Abgeklärtheit, die sie beruhigt. Die Klinik hat einen guten Ruf, seit über fünfunddreissig Jahren werden hier Kinderwunschbehandlungen durchgeführt. Der Arzt erklärt Barbara den Ablauf, angefangen bei der Wahl des Samenspenders. Wie schnell sie den finden könne, fragt er, und Barbara sagt: Schnell.
Barbara klickt sich wie bei einem Onlinekatalog durch Spenderprofile und sucht den biologischen Vater für ihr Kind aus.
Den restlichen Tag verbringt sie auf der Internetseite einer dänischen Samenbank, die Spendersamen und -eizellen für Kliniken bereithält. Barbara klickt sich wie bei einem Onlinekatalog durch Spenderprofile und sucht den biologischen Vater für ihr Kind aus. Es klingt verrückt, sagt Barbara später, aber genau so habe es sich damals angefühlt: wie eine Zalando-Bestellung.
Barbara weiss, dass sie ein Kind will, das Ähnlichkeit mit ihr hat, helle Haut und blonde oder hellbraune Haare. Sie stellt die Filter für den Spender ein: Haar- und Augenfarbe, Grösse, Nationalität, Gewicht. Und dass es eine offene Spende sein soll. Das heisst, ihr Kind kann als Erwachsene:r erfahren, wer der biologische Vater ist, und Kontakt mit ihm aufnehmen. Für die Identitätsfindung, hat sie gelesen, sei das enorm wichtig.
Eine Reihe von Profilen ist zu sehen, jedes mit einem Foto des Spenders als Kind. Klickt Barbara auf ein Profil, erscheint eine detaillierte Beschreibung des Mannes, darunter weitere Infos wie Kleidergrösse, Teint, Haarstruktur, Gesichtsform, Berufsgruppe. Eine Stimm- und Schreibprobe ist angelegt, ebenso ein Fragebogen, in dem er Antworten auf Fragen gibt: «Wovon haben Sie als Kind geträumt?» oder «Was ist Ihre liebste Jahreszeit?»
Nach Rücksprache mit einer Freundin und ihrer Schwester fällt Barbaras Wahl auf einen Dänen. Im Fragebogen steht, dass er humorvoll ist und den Sommer mag. Sein Kinderfoto zeigt ein lachendes, blondes Baby. Barbara bestellt ein Röhrchen mit Spermaproben, ein sogenannter Samenhalm. Sie zahlt um die tausend Euro, und gut 24 Stunden nach Bestellung treffen die Röhrchen bei der Kinderwunschklinik ein. Ein paar Tage nach Barbaras erstem Termin werden die Spermien mit einem weichen Katheter in ihre Gebärmutter gedrückt.
Die zwei Inseminationen laufen ins Leere. Barbara ist enttäuscht, aber aufgeben kommt nicht infrage. Kurz darauf lernt sie einen Mann kennen, sie erzählt ihm von ihrem Kinderwunsch, er ist nicht abgeneigt. Aber Barbara wird nicht schwanger, und der Druck macht beiden zu schaffen. So sehr, dass sie sich nach einem Jahr wieder trennen.
Ein Wärmeschrank in München
Danach fährt Barbara wieder in die Kinderwunschklinik, dieses Mal für die nächste Stufe: in vitro.
Dazu werden Barbaras Eierstöcke mit Hormonspritzen stimuliert, um möglichst viele Eizellen heranreifen zu lassen. Sind diese befruchtungsfähig, wird der Eisprung ausgelöst. Dann werden die Eizellen mit einer feinen Nadel aus den Eierstöcken entnommen und per Mikropipette das ausgewählte Spermium injiziert. Anschliessend kommen die befruchteten Eizellen in einen Spezialschrank, wo sie fünf Tage lang beobachtet werden, bevor eine davon in die Gebärmutter übertragen wird.
Hier, in einem Wärmeschrank in München, beginnt Ennios Leben.
Einige Tage nachdem der Embryo in ihre Gebärmutter eingezogen ist, weiss Barbara, dass es geklappt hat. Sie kennt ihren Körper mittlerweile so gut, dass sie kleinste Zeichen direkt bemerkt: ein starkes flaues Gefühl, Unwohlsein, ein Ziehen im ganzen Körper. Der Schwangerschaftstest zu Hause ist positiv. Kurze Zeit später bestätigt auch die Ärztin in der Schweiz die Schwangerschaft. Barbara ist überglücklich, der Weg scheint frei.
Endlich, denkt sie, kommt alles gut.
Sie ist eine glowing Schwangere, sagen ihr ihre Freundinnen, strahlend, wunderschön. Und glücklich, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Endlich, denkt sie, kommt alles gut. Sie weiss sehr früh, dass das Kind in ihr Ennio heissen wird.
Abends hält sich Barbara manchmal ein kleines Gerät an den Bauch, das sie sich angeschafft hat, um Ennios Herzschlag zu hören. Sie redet ihrem Kind liebevoll zu, wenn es gerade besonders fest an die Bauchdecke tritt. Hallo, kleines Baby. Ich freue mich so fest auf dich. Wir werden es schön haben zusammen.
Bald bist du da.
Keine Kindsbewegungen?
An einem Donnerstagabend, am letzten Tag der vierunddreissigsten Schwangerschaftswoche, liegt Barbara auf ihrem Bett und spielt ein Geschicklichkeitsspiel auf ihrem iPad. Plötzlich stutzt sie. Die Kindsbewegungen, die sie im Liegen sonst immer so ausgeprägt spürt, sind nicht mehr da. Sie stellt ihr Dopplergerät an und hört nach Ennio. Da ist ein dumpfes Pochen, aber das könnte genauso gut ihr eigenes Herz sein. Komm, sagt sie sich, sei nicht eine dieser hypochondrischen Schwangeren. Es wird schon alles gut sein.
Am nächsten Morgen ist Ennio immer noch still. Barbara schreibt eine Mail an ihre Gynäkologin und fährt ins Büro. Geht an eine Sitzung, ist abgelenkt. Die Kollegen fragen: Barbara, bist du noch bei uns? Dann meldet sich die Gynäkologin. Fahren Sie zur Kontrolle ins Spital, schreibt sie.
Es klingt nicht alarmiert, aber auch nicht entspannt.
Kurz nach Mittag erkundigt sich Barbaras Chefin bei der Sekretärin nach ihr. Ich habe ein ungutes Gefühl, sagt die, irgendwas stimmt nicht. Das Team ist eng verbunden, Barbaras Arbeitskolleginnen und -kollegen haben ihren Weg von Anfang an miterlebt. Im Laufe ihrer Schwangerschaft war es ein zärtlicher Running Gag: Ennio ist ein bisschen das Baby von uns allen.
Die Chefin erschrickt, aber mahnt sich zur Zuversicht. Sie hat selbst drei gesunde Kinder. So spät in der Schwangerschaft, sagt sie sich, kann doch eigentlich nichts mehr passieren.
Vier von tausend Kindern
In der Schweiz kommen jährlich vier von tausend Kindern tot zur Welt. Seit den Neunzigerjahren ist diese Rate dank der guten medizinischen Versorgung stabil. Trotzdem gibt es oft keine Erklärung für eine Totgeburt. Das kleine Herz hört plötzlich auf zu schlagen, die Frau muss ein totes Kind gebären. Und damit leben, ohne Antworten.
Barbara weiss es noch nicht, aber auch Ennios Herzschlag hat einfach gestoppt, plötzlich und ohne ersichtlichen Grund.
In einem Berner Spital wird Barbara von einer freundlichen Hebamme in Empfang genommen, die das Messgerät ansetzt.
Wird dieser Panda Warmer das Gerät sein, das mich für immer an den Tod meines Kindes erinnert?
Da sind Herztöne, aber es könnten auch die der Mutter sein. Barbara spürt, wie die Angst in ihr hochkriecht. Eine weitere Hebamme kommt, sie macht einen Ultraschall, niemand sagt etwas. Barbara schaut auf das medizinische Gerät, das vor ihr im Raum steht, sie kennt sogar seine Bezeichnung – Panda Warmer –, ein Wärmebett für die Erstversorgung von Neugeborenen. Sie fragt sich: Wird dieser Panda Warmer das Gerät sein, das mich für immer an den Tod meines Kindes erinnert?
Nach dem Ultraschall teilen die Hebammen Barbara mit, dass sie zu ihrer Gynäkologin in die Praxis fahren soll. Obwohl ihr geraten wird, jemanden mitzunehmen, weiss Barbara sofort, dass sie alleine gehen wird. Sie will diesen Moment niemand anderem antun.
Ist mein Kind tot?
Sie verlässt das Spital, fährt mit dem Tram zur Ärztin. Im Wartezimmer nimmt die Gynäkologin sie an der Hand und führt sie in das Behandlungszimmer. Barbara schaut von der Liege aus in den Monitor des Ultraschallgeräts. Dann fragt sie: Ist mein Kind tot?
Ihre Ärztin macht keine Umschweife.
Ja, Ihr Kind ist tot.
Sie sind Mutter. Und: Sie haben nichts falsch gemacht.
Und dann sagt sie zwei weitere Dinge, die Barbara später, in all der Trauer, wie einen Schatz hüten wird:
Sie sind Mutter. Und: Sie haben nichts falsch gemacht.
Barbara fühlt sich im ersten Moment wie versteinert, sie kann sich nicht bewegen, nichts sagen, auch nicht weinen. Dann sieht sie vor ihrem inneren Auge eine Tür. Sie weiss, dass sie die jetzt sofort aufmachen muss, wenn sie nicht in den Abgrund fallen will, diesen Schlund, der sich unter ihr aufgetan hat. Sie stürzt hindurch. Ennio ist tot, aber der Raum für ein nächstes Kind, ein lebendes, ist offen.
Die Gynäkologin ruft Barbaras Mutter an, sagt: Es geht um Ihre Tochter, sie braucht Sie jetzt.
Ist es schlimm, fragt die Mutter.
Ja, sagt die Gynäkologin. Es sei nicht zu beschreiben, sagen die Eltern später, wie dieser Schmerz aussieht, wenn das eigene Kind sein Kind verliert.
Mis Bébé isch gschtorbe… i mäude mi.
Als sie ihre Eltern in der Trauer sieht, kann auch Barbara endlich weinen. Sie fahren in ihre Wohnung, Barbara schreibt eine Nachricht an ihre Chefin: Mis Bébé isch gschtorbe… i mäude mi.
Sie kenne niemanden, sagt ihre Chefin, wirklich niemanden, der so ein guter Mensch sei wie Barbara. Natürlich verdiene jeder, dass Lebensträume in Erfüllung gehen. Aber Barbara ganz besonders. Wieso musste ausgerechnet ihr das passieren?
Sprachlosigkeit macht nichts ungeschehen. Sie verstärkt den Schmerz, und sie macht ihn diffus. Wie ein Nebel, in dem Ennio überall und nirgends ist. Und die Hinterbliebenen auch.
Das ist Ennios Tod. Ihn nicht auszusprechen, ist schnell getan, ein kleiner Schlenker, ein Schutz vor der Konfrontation. Es ist menschlich, nicht über den Tod reden zu wollen, gerade wenn es um den eines Babys geht, kurz vor der Geburt. Aber Sprachlosigkeit macht nichts ungeschehen. Sie verstärkt den Schmerz, und sie macht ihn diffus. Wie ein Nebel, in dem Ennio überall und nirgends ist. Und die Hinterbliebenen auch.
Nicht verloren gehen
Deshalb hat Barbara mir diese Geschichte erzählt. Um nicht verloren zu gehen. Um andere Eltern darin zu bestärken, nicht verloren zu gehen.
Die Chefin bricht im Büro zusammen. Nie zuvor, sagt sie, habe sie so geweint. Sie sagt alle Termine ab, fährt los und sucht Barbara in mehreren Berner Spitälern, bis die Nachricht kommt, dass sie zu Hause sei. Sie fährt hin und schliesst Barbara in ihre Arme. Dann essen sie zusammen Pasta, sorgen für etwas Normalität in der surrealen Situation.
Barbara sitzt dabei in ihrer Mitte, wie ein verletztes Tier.
Barbara bringt es nicht übers Herz, ihre Schwester, Ennios Gotti, zu informieren. Ihre Mutter ruft sie an und spricht zum ersten Mal den Namen ihres toten Enkels aus. Ennio ist gestorben.
Barbaras Schwester hatte eigentlich eine Reise zu Freunden in der Ostschweiz geplant, sagt aber alles ab und bricht sofort auf. In Barbaras Wohnung trauern sie um Ennio, sprechen wenig, halten sich, zünden Kerzen an. Barbara sitzt dabei immer in ihrer Mitte, wie ein verletztes Tier.
Der Termin für die eingeleitete Geburt ist am nächsten Tag, Samstag, 25. November 2023. Barbara schickt alle nach Hause, sie will die letzte Nacht vor der Geburt alleine verbringen. Dann öffnet sie eine Flasche Weisswein und nimmt ein Schlafmittel. Viele Nachrichten von Freunden erreichen sie, auf jede reagiert sie mit einem Herz. Zu mehr reicht die Kraft nicht.
Das Schönste und Schlimmste
Die Erinnerung an die letzte Nacht mit Ennio im Bauch ist unscharf, die vom Morgen danach auch. Als sie wieder ins Spital fährt, warten ihre Eltern auf sie. Dann wird Barbara ein Einzelzimmer zugewiesen, wo ihr ein Wehenmittel und später eine PDA verabreicht werden. Ennios Gotti kommt vorbei und schenkt ihr eine Halskette mit einem Stern. Barbara wird sie bei der Geburt tragen und ab da jeden Tag.
Um 17 Uhr platzt die Fruchtblase. Die Mutter ist bei ihr im Gebärzimmer, der Vater auf dem Gang. Knapp drei Stunden später presst Barbara ein totes Baby in die Welt: Ennio Liun, 2270 Gramm, 46 Zentimeter. Geboren am 25. November 2023 um 19.55 Uhr.
Es sei vielleicht schwer nachzuvollziehen, sagt Barbara, aber eine solche Geburt könne sie allen empfehlen, die ein totes Kind in sich tragen. Es sei das Schönste und Schlimmste überhaupt. Man würdige damit ein Leben, auch wenn es vorbei ist.
So traurig es ist, so ist es auch enorm herzerwärmend.
In der Nachricht, die sie später verschickt, schreibt sie: Ennio Liun ist gestern in einer wunderschönen Atmosphäre und einer sehr schönen Geburt zur Welt gekommen. Nun liegt er bei mir in den Armen. So traurig es ist, so ist es auch enorm herzerwärmend.
Ennio sieht aus wie die meisten Neugeborenen. Die Wangen ein bisschen blau, eine hübsche Stupsnase über dem kleinen Mund. Die Augen sind zu, als würde er schlafen. Nur seine Haut ist besonders. An gewissen Stellen löst sie sich ab, an anderen ist sie in kleine Falten gelegt, als wäre er noch nicht in sie hineingewachsen.
Glück und Tauer – als wären sie ein und dasselbe Gefühl
Barbara will Ennio sofort halten, ihm ganz nahe sein, am liebsten in ihn hineinkriechen. Es gibt ein Foto aus diesen Stunden, die begleitende Hebamme ist ausserdem professionelle Fotografin und hat Barbara gefragt, ob sie Bilder machen soll. Auf dem Foto sieht man Barbara stehend in einem weissen Oberteil, im Arm noch der Katheter von der Geburt. Sie hält Ennio an ihre Brust gedrückt und schaut direkt in die Kamera. Glück und Trauer sind sich so nahe in diesem Gesicht. Als wären sie ein und dasselbe Gefühl.
Das kleine Baby wird wie ein lebendiges Neugeborenes behandelt, die Hebammen gratulieren Barbara zur Geburt. Erst danach folgt die Beileidsbekundung.
Kaum ist er auf der Welt, kommt Ennios Gotti vorbei. Sie will ihr Patenkind sehen und begrüssen, selbst wenn es zugleich ein Abschied ist. Die Hebamme zieht Ennio eine Windel und einen von Barbara mitgebrachten Strampler an, darauf sind ein Füchslein zu sehen und eine Aufschrift: I’m new here. Das kleine Baby wird wie ein lebendiges Neugeborenes behandelt, die Hebammen gratulieren Barbara zur Geburt. Erst danach folgt die Beileidsbekundung.
Die nächsten Tage bleibt Barbara in dem Zimmer und verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihrem Sohn. Ihre Familie, die Chefin und Freundinnen kommen zu Besuch, die Eltern halten Ennio, die Schwester will erst nicht, dann doch. Dasselbe beim Bruder. Barbaras Patenkind hält Ennio mit einer Selbstverständlichkeit, die alle erstaunt. Auf den Fotos sieht sie gelöst aus, freudig. Und das ist Ennio ja auch: ein Grund zur Freude, ein wunderschönes Baby, ein Familienmitglied, von dem man sich nur sehr früh wieder verabschieden muss.
Bilder von unermesslichem Wert
Eine Freundin kommt vorbei und macht professionelle Fotos von Ennio. Die Bilder, auch die, die direkt nach der Geburt entstanden sind, werden für Barbara später von unermesslichem Wert sein.
Abends gibt Barbara Ennio in den Kühlraum, um den Verwesungsprozess zu verlangsamen. Schon am Sonntag, einen Tag nach der Geburt, ist Ennios Kopf eingesunken, die Mundwinkel zeigen nach unten, die Lippen sind ganz dunkel und die Fingernägelchen violett verfärbt, die Augen sind verklebt. Barbara versucht manchmal, die Lider etwas hochzuschieben, um seine Augen zu sehen, seine Augenfarbe. Es gelingt ihr nicht.
Sie weiss, dass es Verwesungsgeruch ist, aber es ekelt sie nicht. Das ist Ennios Geruch, sie wird ihn nie vergessen.
An einigen Stellen löst sich Ennios Haut ab, an anderen Stellen sieht sie aus wie das Häutchen, das sich über gekochter Milch bildet. Hellweiss, darunter sein dunkelroter, roher Leib. Der Rest von Ennios Körper ist gräulich, magisch fast, wie bei einem Meerwesen. Immer wieder läuft etwas Blut aus seiner Nase. Barbara atmet immer wieder den Geruch ein. Sie weiss, dass es Verwesungsgeruch ist, aber es ekelt sie nicht. Das ist Ennios Geruch, sie wird ihn nie vergessen.
Am Mittwoch in der Früh bringt jemand ein einfaches Holzkistchen aus hellem Holz. Die beiden Hebammen, die Barbara am Tag der Geburt begleitet haben und eigentlich nicht arbeiten müssten, sind auf ihren Wunsch in diesem Moment an ihrer Seite.
Barbara zieht Ennio einen neuen Strampler an, hält ihn, er hängt schlaff in ihren Armen. Behutsam legt sie ihn in das kleine Kistchen. Sie hat zwei kleine gelbe Sterne aus Ton bekommen, einen legt sie neben ihn, einer bleibt bei ihr. «Sternenkind» nennt man Kinder, die im Mutterbauch oder kurz nach der Geburt sterben, wie Wesen aus einer fernen Welt. Der Sarg wird verschlossen.
Während Ennio kremiert wird, machen Barbara und ihre Eltern einen Spaziergang auf dem Gurten, die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Wintertag.
Dem Tod mit dem Leben begegnen
Am nächsten Tag kommt der Schnee. Wie eine Trauerdecke, sagt Barbara, die alles zu ersticken scheint. Zu Hause zieht sie den flauschigen weissen Bärenoverall, den sie für Ennio gekauft hat, über die Urne. Sie hält den jetzt unförmigen Overall mit der Urne darin, um wenigstens etwas in ihren Armen halten zu können. Liebkost ihn, legt ihn in ihr Bett, schläft mehrere Wochen neben ihm.
Sie will ihm Wärme und Geborgenheit geben. Dem Kind, das keines mehr ist.
Es folgen die schlimmsten Wochen ihres Lebens. Barbara hadert mit dem Leben, will überall sein, in der Vergangenheit, in der Zukunft, nur nicht im Hier und Jetzt. Aber sie weiss auch, dass sie die Zeit überleben will. Dem Tod mit dem Leben begegnen, sagt sie sich.
Sie spürt eine Leere im Bauch. Dann, langsam, wie die Organe wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückwandern. Es fühlt sich an wie Kindsbewegungen.
In den ersten Tagen zieht ihre Mutter bei ihr ein, danach schauen immer wieder Freundinnen, die Schwester und Arbeitskolleginnen nach ihr. Bringen Blumen, kochen. Barbara erhält Dutzende von Briefen, kleine Geschenke, Trost spendende Gesten. Viele schreiben, dass sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Auch das spendet Trost. Fast täglich treffen per Kurier Blumensträusse ein und verwandeln die Wohnung in ein buntes Blumenmeer.
Barbara zwingt sich, jeden Tag ein bisschen Programm zu haben. Sie geht viel spazieren, aber fühlt sich abgekoppelt von der Welt, als wäre sie nicht wirklich Teil davon. Sie spürt eine Leere im Bauch. Dann, langsam, wie die Organe wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückwandern. Es fühlt sich an wie Kindsbewegungen.
Auch wenn sich Barbara die Mutterschaft mit einem Partner an ihrer Seite gewünscht hat, so ist sie nach Ennios Tod auch froh, nicht zusätzlich zu allen emotionalen Belastungen noch Angst um eine Beziehung haben zu müssen. Sie weiss aus Erzählungen und Erfahrungsberichten, dass viele Paare an einem solchen Schicksalsschlag zerbrechen.
Thailand, weg von allem
Zwölf Tage nach der Geburt fliegt Barbara nach Thailand. Sie will ganz für sich sein, weg von allem, in der Wärme.
Ihre Eltern, die Schwester und Freundinnen reden es ihr nicht aus, auch wenn sie Angst haben, dass Barbara nicht zurückkommt. Sie bezieht einen Bungalow auf Ko Samui, verbringt jeden Tag am Strand, weint und starrt aufs Meer. Glück verspürt sie keines, auch hier nicht, in Südostasien, wo sie schon seit Jahren immer wieder hinkommt, wenn es ihr nicht gut geht.
Dieses Zimmer, wird Barbara bewusst, ist ihr Versprechen an die Zukunft.
Als Barbara wieder nach Bern zurückkehrt, ist alles noch da. Das Kinderzimmer mit dem Babybett, dem Wickeltisch, der kleinen Regenbogenlampe an der Wand. In der Wickelkommode der Strampler mit Ennios Geruch. Dieses Zimmer, wird Barbara bewusst, ist ihr Versprechen an die Zukunft. Sie stellt nichts um, lässt alles stehen. Die kleine Urne aus weissem Alabaster stellt sie auf die Kommode.
Dort, wo auch ihr Schmuck ist, ihr Deo. Alltagsdinge.
Und dann, allmählich, geschieht das, was vor kurzer Zeit noch undenkbar schien. Was das Leben, wenn man sich dafür entscheidet, eben so macht: Es geht weiter.
Gegen die Zeit
Im Frühjahr sitzt Barbara wieder im Zug nach München, auf dem Weg zur Kinderwunschklinik. Das mag nach Härte klingen, nach bitterer Entschlossenheit, aber Barbara ist ganz anders. Weich, offen, herzlich. Der beste Mensch der Welt, sagen Freundinnen.
In München geht sie in eine nächste Runde. Sie lässt Samenhalme vom selben Spender kommen, das nächste Kind soll Ennios Geschwisterchen sein. Barbara ist sich bewusst, dass die Zeit gegen sie spielt. Frauen, die ab fünfunddreissig schwanger werden, gelten als geriatrische Schwangere, das Fortpflanzungsvermögen sinkt mit zunehmendem Alter.
Barbara ist jetzt einundvierzig. Sie kennt die Zahlen. Und sie ist wie immer vorbereitet. Für den Ernstfall hat sie noch sechs unbefruchtete Eizellen, konserviert in einem Schrank im Inselspital.
Sie will nicht, dass das Geschwister im Schatten von Ennio aufwächst. Es soll sein Eigenes sein dürfen.
Im Juni, ein halbes Jahr nach Ennios Tod, wird Barbara wieder schwanger. Sie ist voller Freude und macht sich Gedanken darüber, wie diese beiden Kinder – das tote und das lebende – nebeneinander existieren werden können. Sie will nicht, dass das Geschwister im Schatten von Ennio aufwächst. Es soll sein Eigenes sein dürfen.
Und dann verliert sie auch dieses Baby. In der neunten Woche hat Barbara eine Fehlgeburt, und obschon sie weiss, wie häufig die bei Frauen in ihrem Alter sind, ist die Trauer darüber gross.
Solche Rückschläge sind hart, sagt Barbara. Sie wissen nicht, wie lange sie das noch durchhalten wird, sagen ihre Freundinnen.
Aber sie sagen auch: Wenn es eine durchzieht, dann Barbara.
Es ist jetzt noch kein Jahr her, seit Ennio gestorben ist. Der letzte Stimulationszyklus war erfolgversprechend, die Chancen stehen gut, dass Barbara wieder schwanger wird. Sie braucht dazu eine gesunde Eizelle, die sich einnistet. Eine einzige nur. Mehr verlange ich nicht, sagt sie.
Wieso weiss man das nicht?
2023 kamen in der Schweiz 334 Kinder tot zur Welt. Nicht hinzugezählt sind die 185 Todesfälle, die sich in den ersten sieben Tagen nach der Geburt ereigneten. Wieso weiss man das nicht, fragt sich Barbara. Wieso wusste sie es nicht, sie, die so viele Zahlen kennt? Wieso wissen alle über den plötzlichen Kindstod Bescheid, der durchschnittlich neun Kinder pro Jahr trifft, aber kaum jemand, dass sehr viele Babys bereits im Mutterbauch sterben?
Hätte das Wissen darüber was geändert?
334.
Das sind viele, sagt Barbara.
Sie weiss noch genau, wie sich Ennios Körper angefühlt hat. Seine Härchen an ihrer Wange. Die faltigen Händchen. Sie wird dieses Gefühl nie vergessen.
Ennio ist einer von Hunderten.
Das ist seine Geschichte.
Informationen zum Beitrag
Veröffentlicht am 3. Oktober 2025
Dieser Beitrag erschien zuerst in Das Magazin 41/2024.
1x pro Woche persönlich und kompakt im mal ehrlich Mail.