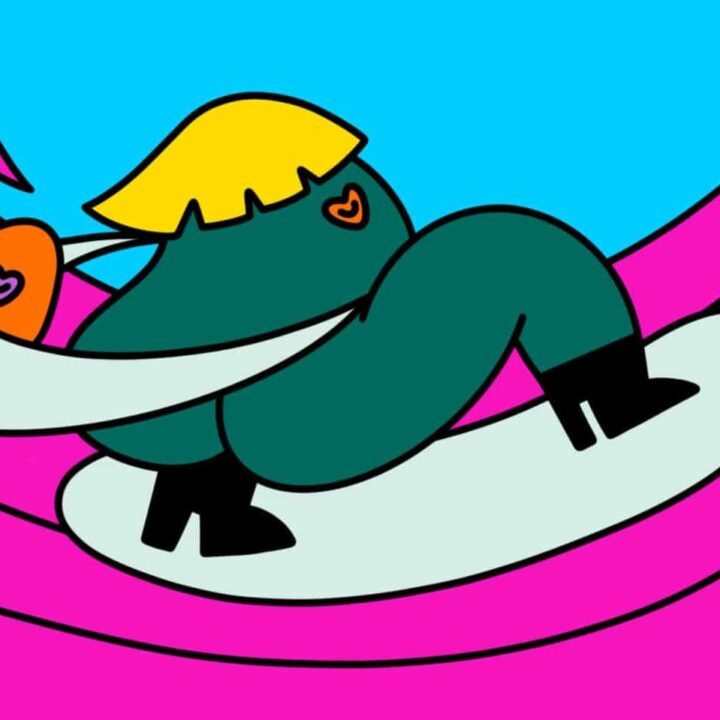Der Mythos der gleichberechtigten Partnerschaft
Wie sieht die Rollenverteilung in Schweizer Haushalten wirklich aus? Paula Scheidt über Mütter und Väter, die Gleichberechtigung wollen, aber nicht leben.

Vor meinem Fenster: Ein junger Mann biegt auf dem Rennvelo um die Ecke, sein T-Shirt flattert im Fahrtwind, Handy, Schlüssel, Kreditkarte stecken wohl im Hosensack. Ein Bild von einem Mann. Ist er auf dem Weg in eine Bar? Trifft er Freunde?
Ach nein, nun taucht eine Frau hinter ihm auf, ausser Atem, sie tritt schwer in die Pedale. An ihrem Velo ist ein Anhänger montiert, darin zwei schreiende Kleinkinder, darauf eine grosse Tasche. Ein Bild von einer Mutter. Ergibt zusammen das Bild von einer Familie, auf Velotour – ungleich verteilte Lasten, vermutlich nicht nur in den Taschen, sondern auch in den Köpfen.
Die Idee der gleichberechtigten Partnerschaft, sie ist romantisch.
Sie ist das, was viele Paare anstreben. Aber irgendwie klappt es dann doch fast nie. Warum nur?
Das Bundesamt für Statistik erhob zuletzt 2017, wie viele Stunden Männer und Frauen unbezahlt für Haushalt und Familie arbeiten. Ob mit oder ohne Familie, ob kleine oder grosse Kinder, ob in Partnerschaft oder alleinerziehend, Frauen machen mehr. Deutlich mehr.
Erstaunlich ist: Auch das Arbeitspensum ist nur ein bescheidener Indikator. Väter von unter sechsjährigen Kindern, die 90 bis 100 Prozent arbeiten, wenden im Durchschnitt zusätzlich 31 Wochenstunden für die Haus- und Familienarbeit auf, Frauen mit dem gleichen Arbeitspensum aber ganze 20 Stunden mehr.
Sogar ein Mann, der nicht erwerbstätig ist, also von morgens bis abends Zeit hätte, sich um Haushalt und Familie zu kümmern, wendet im Durchschnitt 6 Stunden weniger in der Woche für diese Arbeit auf als eine Frau, die in Vollzeit ausser Haus berufstätig ist.
Es mag unrealistisch klingen, bedeutet aber:
Eine Frau mit 40-Stunden-Arbeitswoche arbeitet inklusive Familie und Haushalt 91 Stunden pro Woche.
Sieben Tage die Woche, täglich 13 Stunden. Also eigentlich immer, wenn sie nicht gerade isst oder schläft.
Natürlich kann diese Arbeit vergnüglich sein – ein Telefonat mit der Tante, eine Internetsuche nach einem neuen Duschvorhang, ein Ausflug in den Wald oder die Zubereitung einer Mahlzeit. Aber das alles kostet Zeit, und sie tut es in erster Linie für andere.
Debatten über Gleichberechtigung kreisen oft um die Frage, wie man Frauen beruflich fördern kann, wie es gelingt, dass sie die Arbeitswelt stärker mitgestalten, wie sinnvoll eine Frauenquote für Führungspositionen ist.
Worüber kaum gesprochen wird, ist die Belastung zu Hause.
Welchen Anreiz hat eine Frau, ihr Arbeitspensum zu erhöhen, wenn sie bereits 50 bis 60 Stunden pro Woche – also mehr Zeit, als ein Vollzeitjob beanspruchen würde – für Haushalt und Familie arbeitet. Wie soll sie in einer Chefposition volle Leistung bringen, wenn sie in jeder freien Minute mit einem Lehrer telefoniert oder den Bananenbrei aus den Rillen des Tripp-Trapp-Stuhls kratzt?
Während der Druck auf Männer sinkt, alleine für das Einkommen zu sorgen, ist für Frauen der Druck gleich geblieben, sich um Kinder und Haushalt zu kümmern.
Ein Report der OECD von 2017 nennt denn auch die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen innerhalb der Beziehung als einen der wichtigsten Aspekte unserer Zeit, die es für die Gleichberechtigung zu verbessern gilt.
Natürlich gibt es Männer, die zu Hause konsequent mitdenken und die Hälfte der Arbeit übernehmen – oder sogar mehr. Die gab es immer.
Es gibt Hausmänner, die alles alleine schmeissen. Väter, die sich neben einem Job alleinerziehend um ihre Kinder kümmern. Aber hier soll es um das strukturelle Problem gehen: zu viele Frauen, die zu viel arbeiten.
Als Sabrina (39), Kommunikationsmanagerin aus Zürich, und ihr Mann sich kennenlernten, arbeiteten beide Vollzeit, in ähnlich anspruchsvollen Jobs. Das bisschen Wäschewaschen und Staubsaugen, das ohne Kinder anfällt, teilten sie sich. Dann wurde sie schwanger, nach Geburt und Mutterschaftsurlaub stieg sie mit reduziertem Pensum wieder ein. Inzwischen haben sie drei gemeinsame Kinder im Alter von drei, fünf und acht, und sie wünscht sich, dass auch ihr Mann sein Pensum reduziert, denn auch zu Hause fällt viel Arbeit an.
Kommt er aber abends müde zur Tür herein, dann ist die Familienwohnung für ihn Ort der Entspannung.
Für Sabrina ist die Wohnung ihr zweiter Arbeitsplatz.
Erst die Idee von der gleichberechtigten Partnerschaft, dann der Rückfall in alte Rollen.
Mit der Geburt der Kinder wurden die beiden zu einem der vielen Paare, die sich – zu ihrer eigenen Überraschung – in traditionellen Geschlechterrollen wiederfinden: er als Hauptverdiener, sie als Mädchen für alles. Ein Machtgefälle, das die Beziehung gefährden kann.
Es müsste also allen am Herzen liegen, Frauen wie Männern, dieses Machtgefälle zu verhindern.
Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie verlor Sabrina ihren Job bei einem grossen Verlag aufgrund einer Umstrukturierung. Man könnte meinen, das habe ihr Leben während des Shutdowns erleichtert, denn nun musste sie ihre drei Kinder ganztags mit altersgerechten Rechenaufgaben, Bastelideen und Ausflügen bei Laune halten, weil Schule, Kindergarten und Kita geschlossen waren.
Aber sie sieht es anders: Mit dem Job fiel ihre einzige Möglichkeit weg, sich zu erholen. Sie sagt:
Es ist eine Illusion zu denken, zu Hause sei die Arbeit banaler als im Büro. Das Umgekehrte ist der Fall.
Ein Satz, den ich häufig zu hören bekam, in den vielen Gesprächen mit berufstätigen Müttern, die ich für diesen Artikel geführt habe.
Die New Yorker Psychologin und Journalistin Darcy Lockman schreibt in ihrem Buch «All the Rage – Mothers, Fathers and the Myth of Equal Partnership»: «Die Art und Weise, wie wir tatsächlich leben, scheint nicht mit unseren relativ neuen Idealen mitgehalten zu haben.»
«Verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre» nannte der verstorbene Soziologe Ulrich Beck dieses Verhalten schon in den 1980er-Jahren.
Wieso machen moderne Männer nicht mehr?
Die Suche nach einer Antwort ist unangenehm – nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, weil sie schnell zu Kränkungen und Streit führen kann. Und zwar da, wo es am schmerzhaftesten ist: in der eigenen Paarbeziehung.
Zudem wird es Frauen heutzutage leicht gemacht, dankbar zu sein: Männer heute kümmern sich öfter um ihre Kinder, engagieren sich mehr im Haushalt und befürworten eher die Karriere ihrer Partnerin als die Männer aller vorangegangenen Generationen.
Spricht man mit älteren Frauen, sind sie beeindruckt von den jungen Vätern, die auf Spielplätzen oder in den Strassen mit einem Kinderwagen zu sehen sind. Das gab es nicht, als sie jung waren.
Tatsächlich entspricht es heute dem Selbstbild vieler Väter, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und im Haushalt zu arbeiten.
Engagiertere Väter: Toll? Ja, aber…
Aus historischer Perspektive kann man sich über diesen Fortschritt freuen. Ob er die Erwartungen berufstätiger Mütter an eine faire Aufgabenteilung erfüllt, ist eine andere Frage.
Wenn Judith (33), HR-Fachfrau aus dem Aargau, sich in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis umschaut, dann kommt ihr Mann sehr gut weg. Er arbeitet im 80-Prozent-Pensum, schaut zwei halbe Tage auf die Kinder, drei und fünf, und bringt sie regelmässig abends ins Bett. Aber ihn deshalb gleich aufs Podest heben?
Wenn ein Kind krank ist, ist sie diejenige, die zu Hause bleibt. Wenn die Familie in die Ferien fährt, packt sie die Koffer. Sie macht die Wäsche, geht einkaufen. Sie kocht das Abendessen und steht nachts auf, wenn ein Kind ruft.
Sagt ihr Mann Sätze wie «Jetzt habe ich zwei Stunden auf die Kinder geschaut, damit du putzen kannst» oder «Sei doch froh, andere Partner machen gar nichts im Haushalt», dann wird sie wütend. Sie arbeitet 10 Prozent weniger ausser Haus, aber zu Hause schuftet sie ein Vielfaches mehr.
Die Ungerechtigkeiten können subtil sein.
Der Feminist Nils Pickert, der sich mit männlicher Emanzipation beschäftigt, reflektiert in seinem Buch «Prinzessinnenjungs», einem Plädoyer für eine freiere Erziehung von Buben, auch seine Vorbildrolle als Vater: Er müsse sich selbstkritisch fragen, ob es fair sei, dass er vor allem koche, während seine Frau mehr aufräume. Denn fürs Kochen bekomme man deutlich mehr Anerkennung.
«Einmal im Monat explodiere ich», sagt Judith, die HR-Fachfrau. «Dann kündige ich an, mein Arbeitspensum zu reduzieren mit der Konsequenz: wir hätten weniger Einkommen.» Es ist eine leere Drohung, denn auch Judith erholt sich während der Bürozeiten geistig und körperlich von den Aufgaben zu Hause, wie sie sagt. «Am besten», resümiert sie, «funktioniert es mit klaren Anweisungen.»
Eine Metapher, die immer wieder fällt: Sie ist die Chefin, er der Angestellte. Sie trägt die Verantwortung für Prozesse und Ergebnisse.
Sie initiiert, plant, leitet an und kontrolliert – er führt hauptsächlich aus.
In Firmen heisst diese Arbeit Projektmanagement, ist angesehen und gut bezahlt, auch wenn Aussenstehenden nicht immer klar ist, worin sie genau besteht. Im Privaten soll sie stillschweigend nebenbei erledigt werden – meistens von der Frau.
Ferienwohnung buchen, neue Hockeyschuhe für die Tochter besorgen, alte Kommode auf Ricardo verkaufen, ein vitaminreiches Znüni einpacken, an den Todestag des Grossvaters denken. Erst seit ein paar Jahren etabliert sich für diese Arbeit die Bezeichnung Mental Load, mentale Belastung.
Die meisten Frauen wissen sofort, was mit Mental Load gemeint ist.
Die Berliner Psychologin und Bestsellerautorin Patricia Cammarata beschreibt in ihrem kürzlich erschienenen Buch «Raus aus der Mental Load Falle», wie sie selbst nur knapp einer Erschöpfungsdepression entkam, wie sie auf dem Weg ins Büro jeden Morgen von dem übermächtigen Wunsch gepackt wurde, sich einfach zwischen all den Passanten für ein paar Minuten auf den Asphaltboden zu legen.
«So vergingen Jahre. Jahre, in denen ich mich kraftlos und ständig müde fühlte. Aber das schien normal. Andere Mütter hatten das auch. Die Dauererschöpfung gehörte zum Muttersein, so schien es mir logisch und quasi natürlich. Mütter, die nicht total platt waren, Mütter, deren Kinder durchschliefen, Mütter, die vielleicht nur ein genügsames Kind hatten oder die finanziellen Mittel, um sich zu entlasten, entschuldigten sich bei den Müttern, die fix und alle waren.»
Männer schätzen den Beitrag, den sie zu Hause leisten, oft falsch ein.
Zu diesem Ergebnis kommen diverse internationale Studien, unter anderem eine 2017 durchgeführte Umfrage des «Economist» bei Eltern in acht westlichen Ländern, die ergab, dass 46 Prozent der Väter, aber nur 32 Prozent der Mütter meinen, die Aufgaben zu Hause seien gleichmässig verteilt.
Dass das so ist, liegt auch an der Mental Load. Wenn Haushalt und Familie perfekt gemanagt werden, läuft der Alltag reibungslos, und die Gefahr ist gross, das für selbstverständlich zu halten anstatt für Arbeit.
Beklagen Frauen sich, lautet der gut gemeinte Lösungsvorschlag oft: «Du musst mir halt sagen, was ich tun soll.»
Drandenken ist eben auch ein To-do, auch eine mentale Belastung.
Natürlich können Paare sich dafür entscheiden, dass einer mehr im Haushalt arbeitet, also weniger Freizeit hat.
Hausarbeit kann Spass machen, das kann ein Grund sein. Vielleicht gibt man im Gegenzug die finanzielle Verantwortung ab. Oder, ein häufiges Argument: Wenn die Ansprüche unterschiedlich sind, wie gewissenhaft bestimmte Aufgaben erfüllt werden sollen, dann ist, wer die höheren Ansprüche hat, auch für deren Erfüllung zuständig.
Nach dem Motto: «Wenn es dir so wichtig ist, dass unser Kind Klavier spielen lernt, kannst du es ja zum Unterricht fahren.» Oder: «Ich bin da heikler als mein Partner, deshalb übernehme ich das Putzen.»
Trotzdem führt das Ungleichgewicht meist zu Unmut.
«Wenn mein Mann am Wochenende Velo fahren gehen will, dann verabredet er sich einfach, weil: Ich bin ja zu Hause», sagt Sabina. «Will ich zur gleichen Zeit mit meinen Freundinnen brunchen gehen, muss ich zuerst die Kinder wegorganisieren. Ich rufe die Schwiegereltern oder den Babysitter an, koordiniere die Betreuung, erarbeite mir somit meine Freizeit und verschaffe ihm indirekt auch seine. Er nimmt es für selbstverständlich.»
Manche Männer sind einsichtig. Zum Beispiel Barack Obama.
«Gender-Legacy-Paare» – so werden in der Soziologie Paare genannt, die an ihrem eigenen Ideal einer egalitären Beziehung scheitern. Wegen vermeintlich individueller Entscheidungen, die aber gesellschaftlichen Mustern folgen.
Zu den bekannteren solcher Paare zählen Michelle und Barack Obama. Als ihre beiden Töchter klein waren, verfolgten beide anspruchsvolle berufliche Karrieren, die spätere US-Präsidentschaft lag noch in weiter Ferne.
Barack Obama, der sich als Feminist bezeichnet, reflektierte seine eigenen Unzulänglichkeiten später öffentlich: «Ich kann jetzt zurückblicken und feststellen, dass ich zwar geholfen habe, aber in der Regel nach meinem Zeitplan und zu meinen Bedingungen. Die Last fiel unverhältnismässig stark und unfairerweise auf Michelle.»
Helfen – allein mit diesem Wort drückt man aus, dass die Verantwortung bei jemand anderem liegt.
Wo liegt denn das Problem?
Auf der Suche nach einer Erklärung für die Hartnäckigkeit des Problems wird oft die Biologie bemüht. Gerne möchten wir glauben, die ungleiche Arbeitsverteilung sei irgendwie naturgegeben. Inzwischen ist aber widerlegt, dass es so etwas wie einen Mutterinstinkt gibt: Ein Forscherteam der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv konnte 2014 zeigen, dass die Amygdala – der für Gefühle zuständige Teil des Gehirns – bei Männern die gleiche, erhöhte Aktivität zeigt wie bei Frauen, wenn sie die wichtigste Bezugsperson eines Babys sind.
Mit homosexuellen Probanden gelang der Nachweis, dass für die Entstehung einer starken Bindung nicht das Geschlecht entscheidend ist, nicht einmal die biologische Verwandtschaft, sondern allein, wie viel Zeit man wie intensiv für ein Baby sorgt.
Die Autoren der Studie kamen denn auch zu dem Schluss: «Während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit starke Grundlagen für die mütterliche Fürsorge durch Amygdala-Sensibilisierung liefern, schuf die Evolution andere Wege für die Anpassung an die Elternrolle von Vätern. Und diese alternativen Wege kommen mit Praxis, Einstimmung und täglicher Betreuung.»
Beim Haushalt versteht sich von selbst, dass diese Aufgaben von allen erledigt werden können.
Männer lernen aber früh, dass als typisch weiblich angesehenes Verhalten stigmatisiert ist. Wollen Buben mit einer Puppe spielen oder ein rosa Kleid anziehen, signalisieren wir ihnen, das sei etwas Schlechtes. Buben sollen sich nicht wie Mädchen verhalten; aber wenn Mädchen den Buben nacheifern, finden wir das gut.
So wird Weiblichkeit abgewertet.
Mit Folgen: Schon Beobachtungsstudien an Zweijährigen zeigen, dass Mädchen ihr Spielverhalten auf die Wünsche von Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts hin verändern, Buben lassen sich aber nicht von Mädchen beeinflussen.
Mit dem Älterwerden beginnen Kinder, auf unterschiedliche Weise zu kommunizieren: Mädchen mit eher höflichen Vorschlägen und Buben mit eher direkten Forderungen, wie die Neurowissenschaftlerin Lise Eliot in ihrem Buch «Pink Brain, Blue Brain» beschreibt.
Während Buben weiterhin Einfluss auf alle Kinder ausüben, können Mädchen im Allgemeinen nur andere Mädchen beeinflussen.
In erwachsenen Paarbeziehungen resultiert aus dieser Dynamik ein Verhalten, das der US-amerikanische Psychologieprofessor John M. Gottman «stonewalling» nennt – mauern: Manche Männer ziehen sich gedanklich und emotional aus dem Gespräch zurück, sobald Frauen ein Thema ansprechen.
Gottman schreibt: «Mauerndes Verhalten macht es schwierig für Frauen, ihre Partner zu beeinflussen oder auch nur das Gefühl zu bekommen, dass ihr Unbehagen gehört wird.»
Als Kami (42), Regisseurin und Produzentin aus Locarno, zum ersten Mal schwanger wurde, war sie zweiundzwanzig.
«Das Kind war nicht geplant, aber mein Partner und ich freuten uns, und wir kamen überein, die Kindererziehung fünfzig zu fünfzig aufzuteilen. Ich hatte keinen Grund, an dieser Abmachung zu zweifeln. Die ersten vierzehn Monate stillte ich und kümmerte mich um unser Kind, während er studierte. Dann stand meine Aufnahmeprüfung an einer renommierten Schauspielschule an, worauf ich mich vorbereiten musste. Eine Woche lang, vier Stunden am Tag, sollte er sich um unser gemeinsames Kind kümmern.
Am letzten Tag rief ich ihn auf dem Heimweg an, ich dachte, wir könnten zur Feier des Tages mit dem Baby auswärts essen gehen und uns direkt im Restaurant treffen. Aber er nahm das Telefon nicht ab, und als ich zu Hause ankam, wälzte das Baby sich weinend in seinem Bettchen, während er auf dem Sofa sass und schrie: «Ich halte das nicht aus, ich komme mir vor wie im Gefängnis!»
Anders als Frauen werden Männer kaum darauf vorbereitet, wie enorm die Fremdbestimmung durch Kinder ist.
Männer sind weniger vorgewarnt, dass Eltern zu werden das Leben komplett verändert.
Deshalb kann es passieren, dass der Autonomieverlust von Männern als unerträglich empfunden wird. Oder dass er der Partnerin angekreidet wird statt der Situation, für die ja beide gleichermassen verantwortlich sind.
Frauen hingegen wird früh beigebracht, dass sie ihre Bedürfnisse den Kindern zuliebe zurückstellen müssen mit Sätzen wie: «Als Mutter hast du dafür keine Zeit mehr» oder «Das wäre doch ein Job für dich, da kannst du auch Teilzeit arbeiten».
Nancy J. Chodorow schreibt in dem Standardwerk «The Reproduction of Mothering»: «Fast alle Kinder machen die Erfahrung, dass ihre wichtigsten Bezugspersonen Frauen sind; Mütter erziehen Töchter, die auch bemuttern möchten.»
Dann doch lieber ganz alleine?
Die Regisseurin Kami kam zur Einsicht, dass es besser sei, sich allein um ihr Kind zu kümmern, als mit einem Mann, der sich nicht an die Abmachung einer fairen Aufteilung hält, weil sie ihn überfordert. Sie trennte sich.
«Mir ging es danach besser. Es gab keine spannungsgeladene Luft mehr, kein Lauern, keine Erwartungshaltung, dass er auch etwas macht.»
Ähnlich klingt es bei der Autorin Patricia Cammarata: «Wir trennten uns einige Jahre nach meinem Fastzusammenbruch, und es dauerte bestimmt ein weiteres Jahr, bis ich nicht mehr meinen vollen Mülleimer mit einem absurd glückserfüllten Gefühl zu den Mülltonnen trug, weil ich jetzt nicht mehr darüber verhandeln musste, wann er entsorgt werden muss.
Der Biomülleimer wurde mein Symbol für Freiheit. Ich musste nicht mehr darauf hoffen, dass er sich eines Tages ohne Hinweis leert, es war einfach klar: Ich bringe ihn runter.»
Faule und überforderte Männer, die ihren eigenen Anteil an der Hausarbeit über- und jenen der Partnerin unterschätzen und dabei erst noch unbelehrbar sind: Ist das also das Problem?
Ja, aber nicht das ganze.
Statt eine gleichberechtigte Beziehung gibt es Nörgeln und Trotz.
Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm sieht die Frauen in der Verantwortung. «Offenbar wünschen sich nicht alle Frauen den autonomen Einsatz des Partners», schreibt sie. «Zwar liegt ihnen viel an seiner Beteiligung, trotzdem nörgeln sie an ihm herum, wenn er sich nicht so mit dem Kind oder dem Haushalt beschäftigt, wie sie sich dies vorstellen.»
Diese Mütter würden das Kind stark an sich binden und dem Vater zu verstehen geben, dass er in Betreuung und Haushalt vieles falsch mache. Der soziologische Fachbegriff: Maternal Gatekeeping, mütterliche Torwache. Stamm hat erforscht, dass knapp ein Drittel aller Mütter sich so verhalten.
Als Reaktion auf das Nörgeln zögen viele Männer sich von den häuslichen Aufgaben zurück.
Man versuche, sich die gleiche Dynamik in der Berufswelt vorzustellen: Ein Chirurg erhält im Jahresgespräch das Feedback von seinem Chef, er müsse schneller und sorgfältiger arbeiten, sonst könne man ihm keine weiteren Operationen anvertrauen. Entgegnet der: «Es ist wohl besser, ihr operiert künftig ohne mich. Ich kümmere mich derweil um den Papierkram»?
Unwahrscheinlich. Eher wird er sich anstrengen, üben und beim nächsten Mal besser operieren.
Entwickeln Männer im Privatleben vielleicht einfach nicht den gleichen Ehrgeiz?
Unter dem Titel «Schatz, wo sind die Windeln?» dachte Tobias Moorstedt, freier Autor und Vater, kürzlich im «Tages-Anzeiger» selbstkritisch darüber nach, warum die gesamte Familienplanung bei seiner Frau liegt, die als Ärztin einen unflexibleren, anstrengenderen und verantwortungsvolleren Job hat als er.
«Männer, die sonst immer alles unter Kontrolle haben wollen, behaupten im eigenen Haus: Ich weiss nicht, wie das geht! Soziologen sprechen sogar von strategischer Inkompetenz. Die Botschaft: Jemand anderes muss die Aufgabe erledigen (also die Mutter).»
«Fragen Sie nicht, warum der Wandel so langsam ist; fragen Sie, warum die Männer Widerstand leisten», schreibt der Soziologe Scott Coltrane. «Die kurze Antwort ist, dass es im Interesse der Männer ist, das zu tun.»
Der Widerstand verstärke «eine Trennung der Sphären, die die männlichen Ideale untermauert und eine Geschlechterordnung aufrechterhält, die Männer gegenüber Frauen privilegiert».
Eine Hierarchisierung, die oft unsichtbar ist und nicht nur vielen Männern, sondern auch vielen Frauen als selbstverständlich erscheint, sonst würden sie sich stärker wehren.
Es mag im Interesse vieler Männer sein, sich um die Hausarbeit zu drücken.
Aber es ist sicher nicht in ihrem Interesse, mit ständigen Vorwürfen zu leben – ob ausgesprochenen oder unausgesprochenen – oder gar verlassen zu werden.
Kein Grund zur Aufregung?
Darcy Lockman hat für ihr Buch nicht nur Frauen, sondern auch Männer interviewt und beschreibt, wie schwierig sich das gestaltete. Nicht weil die Männer sich keine Zeit für das Gespräch nahmen. Sondern weil die meisten von ihnen bisher nur oberflächlich über die Arbeitsverteilung zu Hause nachgedacht hatten.
«Für die Väter, so schien es, hat das Thema nie das Niveau wiederkehrender Besorgnis erreicht. Die Geschlechterordnung funktioniert für sie. Es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Sie können sich widersetzen, ohne etwas zu tun. Sie widersetzen sich im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie nichts tun.»
Es gibt ja auch wenig Anreiz, wenn man ehrlich ist. Zwei Wochen Vaterschaftsurlaub wären zwar nicht einmal genug, damit die Frau sich von den Strapazen der Geburt erholen kann, erst recht nicht, um das eigene Kind richtig kennenzulernen, aber selbst diese werden von Arbeitgebern verweigert und politisch bekämpft, wie die aktuellen Debatten in der Schweiz zeigen. (Anm. der Redaktion: Mittlerweile sind 2 Wochen Vaterschaftsurlaub gesetzlich verankert.)
Elternzeit wäre für Männer ein wichtiger Schritt Richtung Fairness zu Hause.
Eine Studie aus dem Jahr 2006, die im «American Sociological Review» publiziert worden ist und mehr als zwanzig Länder über einen Zeitraum von achtunddreissig Jahren untersuchte, zeigt: Väter, die zu Elternzeit berechtigt sind, investieren signifikant mehr Zeit in die Hausarbeit. Staatliche Rahmenbedingungen beeinflussen also individuelle Paarentscheidungen.
«Ein Kind zu bekommen, ist eine enorme zeitliche Investition, weder das Schwangersein noch die Rückbildung laufen nebenbei ab. Partner:innen sollten sich überlegen, wie sie das ausgleichen können. Mehr Care-Arbeit zu übernehmen als die Mutter, wäre das Mindeste, um diese Leistung anzuerkennen», sagt die Feministin Teresa Bücker.
In der Schweiz arbeiten aber noch immer nur 18 Prozent der Männer überhaupt in Teilzeit, und von ihnen geben nur 6 Prozent die Kinderbetreuung als Grund dafür an. Einen längeren Vaterschaftsurlaub zu nehmen, geschweige denn einen Urlaub, der gleich lang wäre wie jener der Mutter, gilt als Extravaganz.
Mit der Konsequenz: Ein Vater bei der Babymassage, in der Spielgruppe, beim Kinderkleiderflohmarkt ist noch lange nicht so selbstverständlich, wie es sein sollte.
Würden wir Kinderbetreuung als die gesellschaftliche Aufgabe anerkennen, die sie ist, und nicht als Privatangelegenheit und sie folglich auch gemeinschaftlich finanzieren wie in anderen Ländern, würden weniger Paare daran scheitern, ihr Ideal einer egalitären Beziehung in die Realität umzusetzen.
Zweifellos streben viele nach diesem Ideal der egalitären Beziehung – bis sie gegen die zahlreichen Hürden anrennen und nach und nach resignieren.
Kostengünstige Kinderbetreuung entlastet fast immer die Frau.
Zum Beispiel dann, wenn der Mann nicht bereit ist, sein Pensum zu reduzieren, der Arbeitgeber es nicht erlaubt oder das Paar es sich finanziell nicht leisten kann.
Solange die gesellschaftliche Default-Lösung für Kinderbetreuung und Haushalt «Frau» heisst, braucht eine egalitäre Arbeitsteilung viel mehr Kraft, als die meisten Frauen und Männer meinen.
«Wenn Paare hart daran arbeiten, in allen Bereichen gleichberechtigt zu leben, insbesondere bei der Kinderbetreuung, kann das klappen; entscheidend ist jedoch, hart zu arbeiten. Und die meisten Männer haben sich nicht dafür entschieden, bei der Kinderbetreuung hart zu arbeiten», schreibt die Literaturwissenschaftlerin Gloria Watkins, die unter dem Pseudonym bell hooks publiziert.
Eine Beziehung wie Jobsharing
Die Psychologin Lockman formuliert drei Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Elternschaft: ein explizites und unerschütterliches Bekenntnis von beiden zur Gleichstellung; dass Väter den regelmässigen und intimen Kontakt zu ihren Kindern geniessen, den oft nur Mütter haben; und dass Väter sich nach der Geburt substanzielle Elternzeit nehmen.
«Unsere Beziehung funktioniert wie Jobsharing», sagt Nicole (49), Juristin aus Kilchberg, die ihre Partnerschaft als gleichberechtigt beschreibt, aber auch als sehr privilegiert: Beide verdienen gut, können flexibel arbeiten, sich eine Putzhilfe leisten und profitieren von der Infrastruktur im stadtnahen Wohnort.
«Wenn ein Kind Husten oder Durchfall hat, dann besprechen wir: Wer hat wann ein Meeting? Welche Termine lassen sich verschieben? Oft geht der eine vormittags und der andere nachmittags ins Büro.»
Ein anderes Beispiel: Kommt der Sohn aus der Schule und bringt eine Einladung zum Kindergeburtstag mit, ist zuständig, wer sie zuerst in die Finger bekommt: Geschenk kaufen, passende Kleider einpacken, Sohn zum Fest fahren. Mit dem wunderschönen Effekt: Beide Elternteile haben eine sehr innige Beziehung zu den Kindern.
Wenn Väter und Kinder Alltag zusammen haben (ohne Mütter!), dann schweisst das extrem zusammen.
Ruft die Lehrerin oder der Kinderarzt auf Nicoles Handy an und die Verantwortung liegt an diesem Tag bei ihrem Mann, dann lässt sie es läuten, denn seine Nummer ist ebenfalls hinterlegt.
Die Autorin Patricia Cammarata rät zu vier konkreten Schritten, um eine faire Arbeitsteilung innerhalb der Beziehung zu etablieren, wenn man es bisher verpasst hat:
Erstens eine detaillierte Bestandsaufnahme aller Aufgaben inklusive Mental Load. Zweitens klar aufteilen, wer wofür zuständig ist. Drittens eine wöchentliche Teamsitzung abhalten, in der Termine besprochen und Aufgaben verteilt werden. Viertens sich einmal im Monat Zeit nehmen, um gemeinsam zu evaluieren, wie es läuft. Wie im Projektmanagement eben.
Nicole, die erfolgreiche Juristin, sagt:
Es braucht mehr Paare, die vorleben, dass es geht.
«Frauen müssen abgeben, Männer müssen übernehmen. Wenn Männer zu Hause mehr mitarbeiten, dann steigt die gesellschaftliche Wertschätzung für diese Arbeit.»
Und das müsste sie doch für mehr Männer reizvoll machen.
Informationen zum Beitrag
Dieser Beitrag erschien erstmals am 30. November 2020 bei Any Working Mom, auf www.anyworkingmom.com. Any Working Mom existierte von 2016 bis 2024. Seit März 2024 heissen wir mal ehrlich und sind auf www.mal-ehrlich.ch zu finden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in Das Magazin 36/2020
1x pro Woche persönlich und kompakt im mal ehrlich Mail.